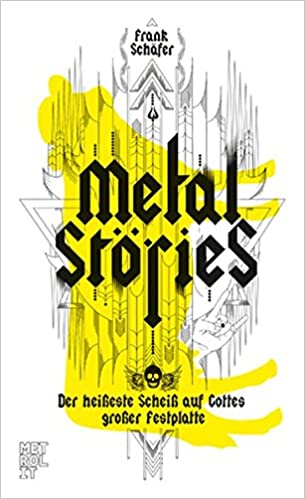 Wer diese Rubrik hier mehr oder weniger regelmäßig verfolgt, wird wissen, dass ich viel von Frank Schäfer lese, jenem Braunschweiger Dr. phil., der regelmäßig Bücher über seine Hardrock- und Metal-Leidenschaft veröffentlicht, für Musikmagazine schreibt und zudem ein ausgewiesener Literaturexperte ist, der auch gern autobiographische Romane verfasst und einst bei Salem’s Law Gitarre spielte. Der Ursprung meines Interesses liegt in seinen „Metal Störies“ begründet, die im Jahre 2013 im Berliner Metrolit-Verlag erschienen. Ich war seinerzeit über eine Kurzkritik im Rock Hard gestolpert, hatte mir das rund 150 Seiten umfassende Buch im festen Einband schenken lassen und war nach der Lektüre derart angetan, dass ich mir zahlreiche seiner vorausgegangenen Werke zu Gemüte führte. Chronologisch bin ich jetzt quasi wieder im Jahre 2013 angelangt. Da ich seinerzeit noch kein Lesetagebuch führte, las ich die „Metal Störies“ einfach noch mal, um nun endlich auch zu ihnen etwas schreiben zu können.
Wer diese Rubrik hier mehr oder weniger regelmäßig verfolgt, wird wissen, dass ich viel von Frank Schäfer lese, jenem Braunschweiger Dr. phil., der regelmäßig Bücher über seine Hardrock- und Metal-Leidenschaft veröffentlicht, für Musikmagazine schreibt und zudem ein ausgewiesener Literaturexperte ist, der auch gern autobiographische Romane verfasst und einst bei Salem’s Law Gitarre spielte. Der Ursprung meines Interesses liegt in seinen „Metal Störies“ begründet, die im Jahre 2013 im Berliner Metrolit-Verlag erschienen. Ich war seinerzeit über eine Kurzkritik im Rock Hard gestolpert, hatte mir das rund 150 Seiten umfassende Buch im festen Einband schenken lassen und war nach der Lektüre derart angetan, dass ich mir zahlreiche seiner vorausgegangenen Werke zu Gemüte führte. Chronologisch bin ich jetzt quasi wieder im Jahre 2013 angelangt. Da ich seinerzeit noch kein Lesetagebuch führte, las ich die „Metal Störies“ einfach noch mal, um nun endlich auch zu ihnen etwas schreiben zu können.
Schäfer verknüpft hier in 24 Kapiteln plus „Bonustrack“ Anekdoten aus seiner Jugend in der niedersächsischen Provinz mit, nun ja, Hardrock und Heavy Metal eben, und das in sehr eloquenter, zugleich sympathisch geschriebener Form, für die er viel mehr mit dem Herzen denn verkopft analytisch bei der Sache ist. Gut, mittlerweile weiß ich, dass das zweite Kapitel über seinen Besuch des „Monsters of Rock“-Festivals bereits 13 Jahre zuvor im von ihm herausgegebenen „The Boys Are Back In Town. Mein erstes Rockkonzert“ abgedruckt worden war – dass er inmitten des Iron-Maiden-Sets einfach abhaute, ist indes nach wie vor unfassbar. Weiter geht’s mit seiner eigenen Band und deren Auftritt auf dem Helmstedter Festival zu unmöglichen Bedingungen: Pay to play für 2.000 Kracher! Neben Kritik am Verhalten der Kollegen von Sinner erhält man hier aufschlussreiche Blicke hinter die Kulissen, nicht nur des Festivals, sondern auch der Tele5-Ausstrahlug von Teilen des Festivals. Das zu lesen, diese Zeitreise in die Metal-Parallelwelt der 1980er in der deutschen Provinz, kombiniert mit dem frühen deutschen Privatfernsehen, ist purer Genuss, immerhin war Tele5 mein damaliger Leib-und-Magen-Sender: Als musikbegeisterter Grundschüler und Metal-Fan ohne Kabelanschluss erlebte ich dort nicht nur die Abenteuer der Masters of the Universe und zahlreicher weiterer Zeichentrick-Heldinnen und -Helden, Tele5 wurde auch zu einer Art MTV-Ersatz: Man teilte sich den Sendeplatz mit RTL plus und zeigte nicht nur unzählige Musikvideos, sondern hatte mit „Hard’n’Heavy“ auch eine eigene Metal-Sendung im Programm, die ich ebenso fasziniert wie begeistert verfolgte und dadurch auf etliche Bands stieß, die ich bis heute höre. Der trashige Charme der Moderationen Annette Hopfenmüllers, vor allem aber der häufig ohne Budget hastig von Tele5 selbst gedrehten Videoclips (welche kleinere Metal-Band hatte damals schon eigene, professionelle Clips im Gepäck?) erschloss sich mir erst später, was es aber irgendwie noch schöner machte.
Weiter erinnert sich Schäfer zurück an den Erwerb seiner erste Hifi-Anlage und E-Gitarre, daran, wie er in der Musiksammlung seines großen Bruders stöberte und schließlich Thin Lizzy entdeckte, die er sich erst „erarbeiten“ musste (zuvor, so meine ich mich zu erinnern, bereits in Schäfers 2010 erschienener Essay-Sammlung „Alte Autos und Rock’n’Roll“ veröffentlicht). „An einem dieser Nachmittage wurde mir euphorisch bewusst, dass ich nie wieder Langeweile haben würde“, heißt es da, was die persönliche Gemütslage nach dem Aufstoßen eines Tors in eine ganz eigene, faszinierende musikalische und subkulturelle Welt schön zusammenfasst. Und da ich ohnehin schon zitiere, gleich noch ein Beispiel für Schäfers Wortgewandtheit, sein Talent, Leidenschaft in Worte zu fassen:
„Eine Platte existierte in unserem Hörerkreis exakt einmal. Und wir behandelten sie wie einen Heilsspender, wie ein Palliativ. […] Wir wiesen diesem einen Album einen bestimmten Platz zu in unserem Leben, und dort lud es sich mit Bedeutung auf. Stimmungen, Erinnerungen, Affekte gingen eine haltbare Verbindung mit ihm ein, blieben jederzeit abrufbar. Und wir gaben dem tausendfach vervielfältigten Kunstwerk seine Einmaligkeit zurück.“
Wunderbar auf den Punkt gebracht ist die Polemik gegen Akustik-Sets von Metal-Songs, die Danksagung an Schäfers Vater ist rührend und der Bericht vom Besuch des Ozzfests als Journalist, der anschließend ein Type-0-Negative-Interview durchführen durfte, humorgespickt und launig. Das sind auch die angenehm vielen Geschichten über Salem’s Law, stets selbstironisch als „ihrer Zeit um Jahrzehnte vorauseilende Prog-Metal-Band“ bezeichnet. Eine Hommage an die dänische Band D.A.D. verbindet Schäfer mit klugen Worten zur damaligen Aufsplitterung des Hardrock- und Metal-Bereichs in zahlreiche, sich mitunter spinnefeind gegenüberstehende Subgenres und zur Tonträger-Veröffentlichungsflut, die bis heute nie geahnte Ausmaße angenommen hat. Leider ist dieses Kapitel auch mit der Auflösung seiner Band verbunden.
Der Autor schreibt über einen Hellacopters-Gig, dem er im Hamburger Molotow (nicht Molotov, Herr Schäver!) beiwohnte, um kurz darauf zu sehr Persönlichem zurückzufinden, indem er eine Braunschweiger Beziehungskiste mit der Fahrt zum Thin-Lizzy-Reunion-Konzert kombiniert. In diesem Kontext nimmt er erneut kleinteilige Liebeserklärungen an die Band vor – wunderschön melancholisch erzählt. Ein Kumpel crowdsurft bei Rose Tattoo, auf Wacken wird im Regen gegrillt und Rage werden gefeiert, jeweils garniert mit Schmunzelanekdoten. Und nachdem ich ja nun zum zweiten Mal die Abhandlung über Van Halen gelesen habe, die Schäfer mit einer Rezension des David-Lee-Roth-Comeback-Albums verbindet, muss ich mir das – Memo an mich – wohl auch endlich einmal anhören. Wenn ich schon mal dabei bin, sollte ich mir offenbar auch die Van-Halen/Lee-Roth-Reunion bei MTV 1996 angucken…
Das Gedächtnisprotokoll einer Lesung in Thüringen ist herrlich ironisch-süffisant, die Abi-Fetengeschichte hat aber nun wiederum so gut wie gar nichts mit Metal oder Artverwandtem zu tun (es sei denn, man zählt saufen dazu). Sei’s drum, denn Schäfer schließt versöhnlich mit ehrlicher Freude über die Wiederentdeckung seiner Band unter Metal-Archäologen und übt, last but not least, im Bonuskapitel gerechtfertigte Wacken-Kritik.
„Metal Störies“ vereint in seinen prosaischen Anekdoten persönliche Erinnerungen zwischen Witz und Melancholie, Bandbiographie(n), Konzertberichte, Kommentare und Hintergründe zur Pop- und Rockkultur sowie Plattenkritiken auf scheinbar leichtfüßige Weise und liest sich dank Schäfers Hingabe derart geschmeidig, dass man – einen entsprechenden Bezug zur genannten Themenwelt vorausgesetzt – schnell mehr will. Im Bereich „Sachbuch Musik“ (was viel zu spröde klingt und diesem Buch nicht gerecht wird) war „Metal Störies“ vielleicht Schäfers bis dahin rundestes Stück Literatur, das in mir einen dankbaren und inspirierten Abnehmer fand. Sobald es Zeit und Prioritäten erlauben, greife ich mir das nächste.

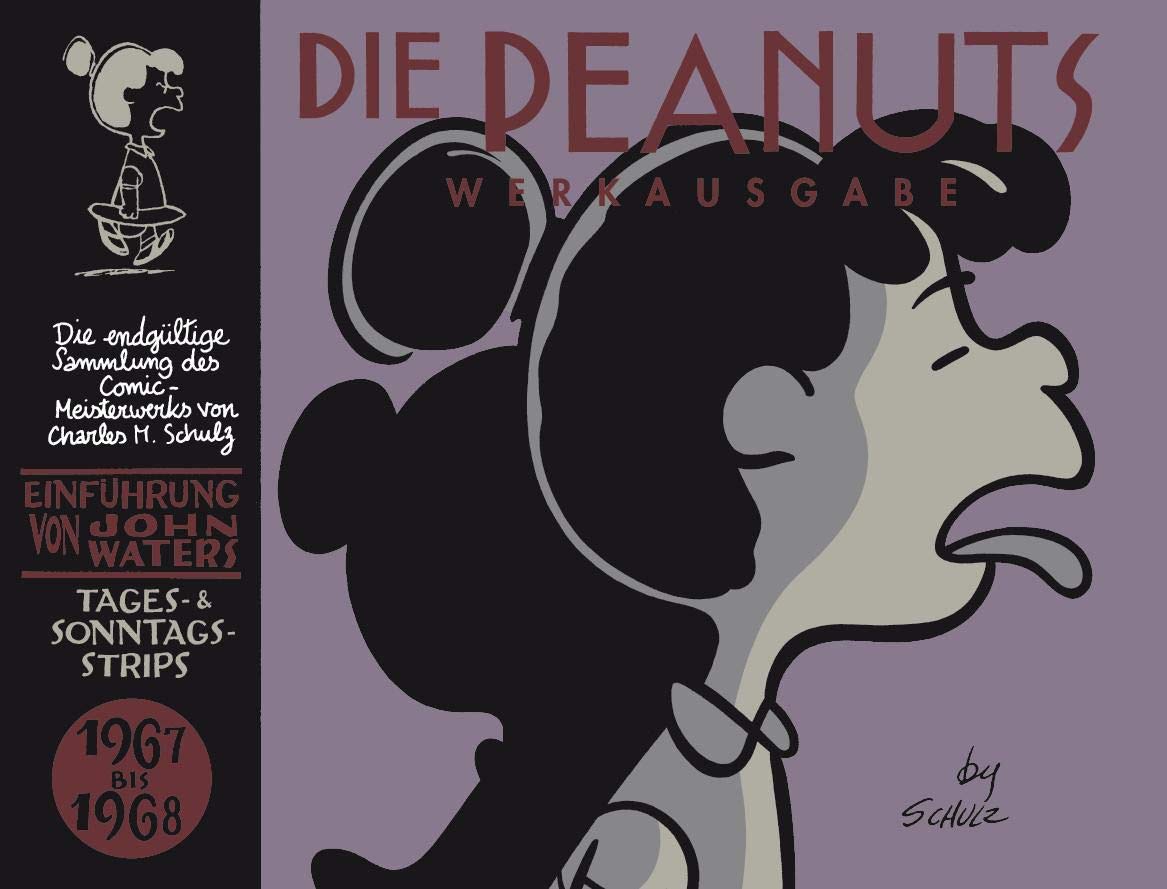
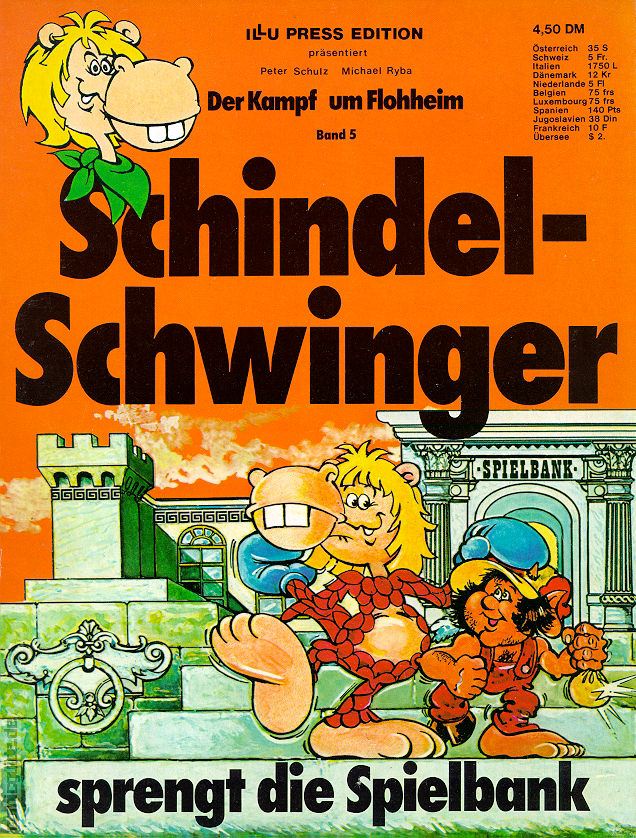 „Schindel-Schwinger: Kampf um Flohheim“ war eine von 1975 bis 1977 im Illu-Press-Verlag in Form rund 50-seitiger großformatiger Softcover-Alben erschienene Comicreihe aus der Feder Peter Schulz‘ und Michael Rybas. Die auf drei Seiten umrissene Rahmenhandlung dieser vollfarbigen Anarcho-Funnys bilden die verzweifelten Versuche Gottes, seine „Proben“, Prototypen von Geschöpfen, die es eigentlich nicht bis zur Schöpfung geschafft haben, wieder einzufangen, nachdem er diesen irren Kreuzungen aus Merkmalen verschiedenster Tiere mit den Attitüden unterschiedlichster Menschen versehentlich Leben eingehaucht und sie entkommen lassen hat. Am Tullamore-Fluss haben sie die Stadt Flohheim gegründet, wo sie aber nicht in Frieden leben können, weil Gott sowohl Petrus als Luzifer auf sie gehetzt hat. Wer sie einfängt und ihm wiederbringt, soll später einmal die Erde beherrschen dürfen. Doch die Bewohnerinnen und Bewohner Flohheims wissen sich zu wehren.
„Schindel-Schwinger: Kampf um Flohheim“ war eine von 1975 bis 1977 im Illu-Press-Verlag in Form rund 50-seitiger großformatiger Softcover-Alben erschienene Comicreihe aus der Feder Peter Schulz‘ und Michael Rybas. Die auf drei Seiten umrissene Rahmenhandlung dieser vollfarbigen Anarcho-Funnys bilden die verzweifelten Versuche Gottes, seine „Proben“, Prototypen von Geschöpfen, die es eigentlich nicht bis zur Schöpfung geschafft haben, wieder einzufangen, nachdem er diesen irren Kreuzungen aus Merkmalen verschiedenster Tiere mit den Attitüden unterschiedlichster Menschen versehentlich Leben eingehaucht und sie entkommen lassen hat. Am Tullamore-Fluss haben sie die Stadt Flohheim gegründet, wo sie aber nicht in Frieden leben können, weil Gott sowohl Petrus als Luzifer auf sie gehetzt hat. Wer sie einfängt und ihm wiederbringt, soll später einmal die Erde beherrschen dürfen. Doch die Bewohnerinnen und Bewohner Flohheims wissen sich zu wehren.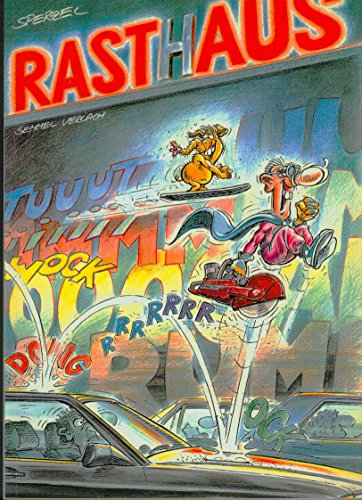 Nachdem Wahlhamburger und Comiczeichner Wolfgang Sperzel 1989 im Semmel-Verlach mit seinem Album „Kabelbrand im Herzschrittmacher“ debütiert hatte, folgte zwei Jahre später ebendort der Nachfolger „Rast(h)aus“. Das großformatige Softcover-Album umfasst rund 50 vollfarbige, handgeletterte Seiten mit dynamischen Panel-Grids, die vor allem eines sind: ein im Funny-Stil gezeichneter Amoklauf gegen die Hamburger Verkehrssituation.
Nachdem Wahlhamburger und Comiczeichner Wolfgang Sperzel 1989 im Semmel-Verlach mit seinem Album „Kabelbrand im Herzschrittmacher“ debütiert hatte, folgte zwei Jahre später ebendort der Nachfolger „Rast(h)aus“. Das großformatige Softcover-Album umfasst rund 50 vollfarbige, handgeletterte Seiten mit dynamischen Panel-Grids, die vor allem eines sind: ein im Funny-Stil gezeichneter Amoklauf gegen die Hamburger Verkehrssituation.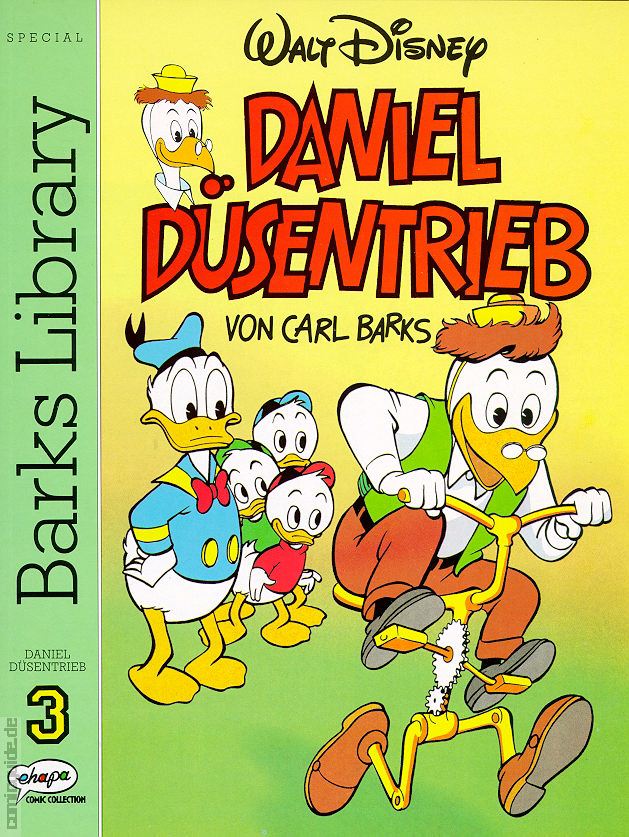 Einer der Ableger der herkömmlichen Barks Library des Ehapa-Verlags, die sämtliche Comics des Erfinders der Familie Duck, Carl Barks, umfasst, ist die sechs Alben umfassende Daniel-Düsentrieb-Reihe, die sich ganz dem Entenhausener Erfinder widmet. Dieser mir vorliegende dritte Band der Reihe erschien im Jahre 1994 und enthält auf rund 60 Seiten sieben mehrseitige Geschichten, zwei Onepager sowie einen zweiseitigen Essay Geoffrey Blums und den ersten Teil eines Nachschlagewerks der Erfindungen Düsentriebs und ihres Auftauchens in den Comics. Das Inhaltsverzeichnis gibt zudem Auskunft über die US-amerikanischen und deutschen Erstveröffentlichungen. Einer der Onepager und eine mehrseitige Geschichte wurden hiermit erstmals in Deutschland veröffentlicht und eigens von Stammübersetzerin Dr. Erika Fuchs übersetzt. Alle Comicseiten sind koloriert.
Einer der Ableger der herkömmlichen Barks Library des Ehapa-Verlags, die sämtliche Comics des Erfinders der Familie Duck, Carl Barks, umfasst, ist die sechs Alben umfassende Daniel-Düsentrieb-Reihe, die sich ganz dem Entenhausener Erfinder widmet. Dieser mir vorliegende dritte Band der Reihe erschien im Jahre 1994 und enthält auf rund 60 Seiten sieben mehrseitige Geschichten, zwei Onepager sowie einen zweiseitigen Essay Geoffrey Blums und den ersten Teil eines Nachschlagewerks der Erfindungen Düsentriebs und ihres Auftauchens in den Comics. Das Inhaltsverzeichnis gibt zudem Auskunft über die US-amerikanischen und deutschen Erstveröffentlichungen. Einer der Onepager und eine mehrseitige Geschichte wurden hiermit erstmals in Deutschland veröffentlicht und eigens von Stammübersetzerin Dr. Erika Fuchs übersetzt. Alle Comicseiten sind koloriert.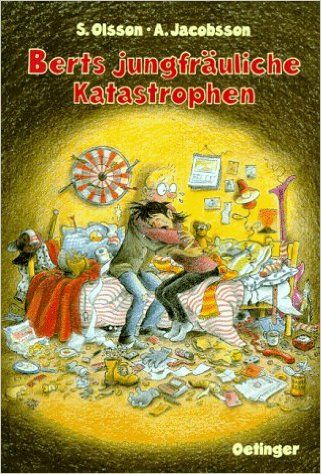 Katastrophen und kein Ende in Sicht – so nicht nur in der realen Welt, sondern auch in der relativ behüteten des pubertierenden schwedischen Jungen Berg Ljung, „Held“ einer fünfzehnbändigen Jugendbuchreihe der schwedischen Vettern, Lehrer und Schriftsteller Sören Olsson und Anders Jacobsson. Diese enthalten Berts Tagebucheinträge vom zwölften bis zum 17. Lebensjahr und bilden so etwas wie eine launige, sich eigentlich eher an Gleichaltrige richtende Coming-of-Age-Reihe, die zwischen 1987 und 1999 im schwedischen Original und zwischen 1990 bis 2005 in den deutschen Fassungen bei der Verlagsgruppe Friedrich Oetinger erschien.
Katastrophen und kein Ende in Sicht – so nicht nur in der realen Welt, sondern auch in der relativ behüteten des pubertierenden schwedischen Jungen Berg Ljung, „Held“ einer fünfzehnbändigen Jugendbuchreihe der schwedischen Vettern, Lehrer und Schriftsteller Sören Olsson und Anders Jacobsson. Diese enthalten Berts Tagebucheinträge vom zwölften bis zum 17. Lebensjahr und bilden so etwas wie eine launige, sich eigentlich eher an Gleichaltrige richtende Coming-of-Age-Reihe, die zwischen 1987 und 1999 im schwedischen Original und zwischen 1990 bis 2005 in den deutschen Fassungen bei der Verlagsgruppe Friedrich Oetinger erschien. Der für seine Sportbücher bekannte Göttinger Die-Werkstatt-Verlag veröffentlichte im Jahre 2010 diese rund 160-seitige Anekdotensammlung, die im Taschenbuchformat 25 Geschichten aus der von Herausgeber Sascha Theisen initiierten „Torwort“-Lesereihe umfasst. Gesprochenes nun also erstmals zum gemütlichen Nach- oder Erstlesen, handverlesen, kuratiert und mit sieben eigenen Beiträgen vom Herausgeber angereichert.
Der für seine Sportbücher bekannte Göttinger Die-Werkstatt-Verlag veröffentlichte im Jahre 2010 diese rund 160-seitige Anekdotensammlung, die im Taschenbuchformat 25 Geschichten aus der von Herausgeber Sascha Theisen initiierten „Torwort“-Lesereihe umfasst. Gesprochenes nun also erstmals zum gemütlichen Nach- oder Erstlesen, handverlesen, kuratiert und mit sieben eigenen Beiträgen vom Herausgeber angereichert. Der gebürtige Tscheche Hans Traxler gehörte zur Redaktion des „Titanic“-Satiremagazins und verdingte sich als Cartoonist, Illustrator und Autor. In seinem Buch „Die Wahrheit über Hänsel und Gretel“, ursprünglich im Jahre 1978 im Frankfurter Zweitausendeins-Verlag erschienen, begab er sich aufs Gebiet der „Märchenarchäologie“ und kam mit wissenschaftlicher Akribie einem handfesten Skandal und kaltblütigen Mordfall auf die Spur, den die Gebrüder Grimm mit ihrem berühmten Volksmärchen zu vertuschen halfen. Mir liegt ein Exemplar der Auflage aus dem Jahre 1988 der seit 1983 bei Rowohlt verlegten Taschenbuchausgabe vor. Über rund 120 Seiten inklusive Fotografien Peters v. Tresckows, dem originalen Märchen, Literaturverzeichnis, Zeittafel und Personen-/Sachregister erstrecken sich Traxlers Forschungen, mit denen er bei Georg Ossegg, dem Erfinder der Märchenarchäologie, anknüpfte – und die eine ganz vorzügliche Satire auf (Pseudo-)Wissenschaften darstellen.
Der gebürtige Tscheche Hans Traxler gehörte zur Redaktion des „Titanic“-Satiremagazins und verdingte sich als Cartoonist, Illustrator und Autor. In seinem Buch „Die Wahrheit über Hänsel und Gretel“, ursprünglich im Jahre 1978 im Frankfurter Zweitausendeins-Verlag erschienen, begab er sich aufs Gebiet der „Märchenarchäologie“ und kam mit wissenschaftlicher Akribie einem handfesten Skandal und kaltblütigen Mordfall auf die Spur, den die Gebrüder Grimm mit ihrem berühmten Volksmärchen zu vertuschen halfen. Mir liegt ein Exemplar der Auflage aus dem Jahre 1988 der seit 1983 bei Rowohlt verlegten Taschenbuchausgabe vor. Über rund 120 Seiten inklusive Fotografien Peters v. Tresckows, dem originalen Märchen, Literaturverzeichnis, Zeittafel und Personen-/Sachregister erstrecken sich Traxlers Forschungen, mit denen er bei Georg Ossegg, dem Erfinder der Märchenarchäologie, anknüpfte – und die eine ganz vorzügliche Satire auf (Pseudo-)Wissenschaften darstellen. Von 1993 bis 2004 erschien im Braunschweiger Verlag Andreas Reiffer die Social-Beat-Literaturzeitschrift SUBH – die nie meine Wege kreuzte. Die Sonderausgabe Nummer 7 aus dem Jahre 1997 entdeckte ich jedoch in einem Hamburger Tauschschrank. Das wie ein DIN-A5-Fanzine aussehende, 48-seitige Heft trägt den Titel „Kreuzigungs-Patrouille Karasek – Neues aus der Braunschweiger Sonderschule“ und enthält Kurzgeschichten des Punk-Literaten Jan Off (offenbar seine dritte Veröffentlichung überhaupt) sowie Comics und Zeichnungen Knut Gabels. Die Geschichten sind sauber zweispaltig im Blocksatz gesetzt und wurden von Gabel mit großflächigen Schwarzweißzeichnungen eher groben Strichs illustriert. Offs „Deutschnationale Turnstunde“ greift die Obrigkeitshörigkeit von Neonazis auf und macht sich über sie in einer fiktionalen Farce lustig, während er in „Muttertag“ Besuch von der Schamhaar-Polizei sowie diverse Anrufe, u.a. von Bundespräsi Roman Herzog und seiner Mutter, erhält. „Fotze“ schreibt er mit „V“. Gabels Funny-Comic „Münster – Krone der Gastlichkeit“ lebt von Asi-, Ekel- und Gewalt-Humor, der eigentliche Kniff aber ist die bewusst angesetzte Schere zwischen dem Gezeichneten und dem seriös geschriebenen Erzähltext.
Von 1993 bis 2004 erschien im Braunschweiger Verlag Andreas Reiffer die Social-Beat-Literaturzeitschrift SUBH – die nie meine Wege kreuzte. Die Sonderausgabe Nummer 7 aus dem Jahre 1997 entdeckte ich jedoch in einem Hamburger Tauschschrank. Das wie ein DIN-A5-Fanzine aussehende, 48-seitige Heft trägt den Titel „Kreuzigungs-Patrouille Karasek – Neues aus der Braunschweiger Sonderschule“ und enthält Kurzgeschichten des Punk-Literaten Jan Off (offenbar seine dritte Veröffentlichung überhaupt) sowie Comics und Zeichnungen Knut Gabels. Die Geschichten sind sauber zweispaltig im Blocksatz gesetzt und wurden von Gabel mit großflächigen Schwarzweißzeichnungen eher groben Strichs illustriert. Offs „Deutschnationale Turnstunde“ greift die Obrigkeitshörigkeit von Neonazis auf und macht sich über sie in einer fiktionalen Farce lustig, während er in „Muttertag“ Besuch von der Schamhaar-Polizei sowie diverse Anrufe, u.a. von Bundespräsi Roman Herzog und seiner Mutter, erhält. „Fotze“ schreibt er mit „V“. Gabels Funny-Comic „Münster – Krone der Gastlichkeit“ lebt von Asi-, Ekel- und Gewalt-Humor, der eigentliche Kniff aber ist die bewusst angesetzte Schere zwischen dem Gezeichneten und dem seriös geschriebenen Erzähltext. Die Einbandgestaltung mit auffällig roter Farbe, Straßenprotestfoto und stilisiertem „Antifa-proof“-Störer ist anscheinend darauf ausgerichtet, ein entsprechend affines Publikum anzusprechen. Dieses dürfte jedoch schnell dahinterkommen, dass dieses 100-seitige Mini-Taschenbüchlein ein sog. Missionstool (Selbstbezeichnung) des christlichen Münchner Soulbooks-Verlags ist, das 2015 in seiner ersten Auflage erschien und gestaffelt ab 1,- EUR abwärts rausgehauen wird, also in größerer Menge beispielsweise für Straßenmissionierungsaktionen erworben werden kann.
Die Einbandgestaltung mit auffällig roter Farbe, Straßenprotestfoto und stilisiertem „Antifa-proof“-Störer ist anscheinend darauf ausgerichtet, ein entsprechend affines Publikum anzusprechen. Dieses dürfte jedoch schnell dahinterkommen, dass dieses 100-seitige Mini-Taschenbüchlein ein sog. Missionstool (Selbstbezeichnung) des christlichen Münchner Soulbooks-Verlags ist, das 2015 in seiner ersten Auflage erschien und gestaffelt ab 1,- EUR abwärts rausgehauen wird, also in größerer Menge beispielsweise für Straßenmissionierungsaktionen erworben werden kann.