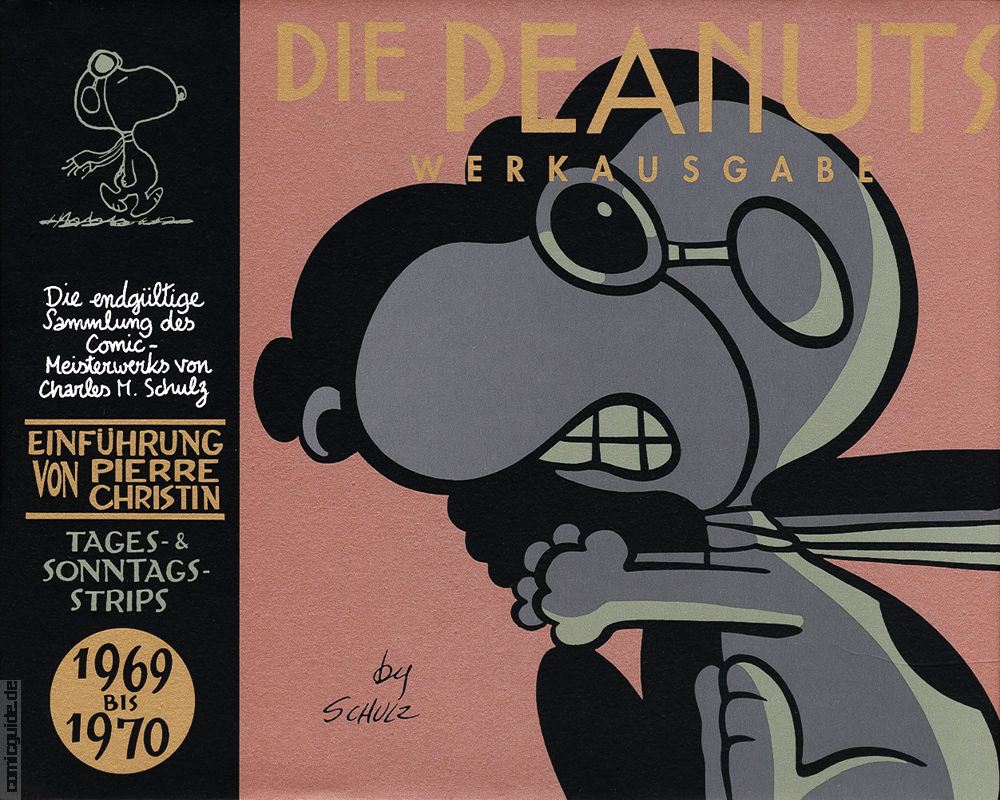Eine der faszinierendsten (Super-)Helden-Comic-Reihen ist seit jeher Batman, gerade weil er über gar keine Superkräfte verfügt. Von DC im Jahre 1939 erstmals ins Rennen geschickt, durchlebte der dunkle Ritter zahlreiche Metamorphosen, Spin-Offs und Reboots. Im Jahre 1999, also zum sechzigjährigen Jubiläum, stellte der deutsche Dino-Verlag für diesen Sonderband besonders relevante oder herausragende Batman-Comics aus den 1960ern zusammen, um sie auf rund 150 Seiten angereichert mit zahlreichen Hintergrundinformationen und einem eingehefteten Bastelbogen (für je einen Batman- und Robin-Aufsteller) neu zu präsentieren und so nachgewachsenen Leserinnen- und Lesergenerationen nahezubringen. Es handelt sich um einen vollfarbigen, handgeletterten Softcover-Band im bewährten Heftchenformat, der dem 1998 verstorbenen Batman-Erfinder Bob Kane gewidmet ist.
Eine der faszinierendsten (Super-)Helden-Comic-Reihen ist seit jeher Batman, gerade weil er über gar keine Superkräfte verfügt. Von DC im Jahre 1939 erstmals ins Rennen geschickt, durchlebte der dunkle Ritter zahlreiche Metamorphosen, Spin-Offs und Reboots. Im Jahre 1999, also zum sechzigjährigen Jubiläum, stellte der deutsche Dino-Verlag für diesen Sonderband besonders relevante oder herausragende Batman-Comics aus den 1960ern zusammen, um sie auf rund 150 Seiten angereichert mit zahlreichen Hintergrundinformationen und einem eingehefteten Bastelbogen (für je einen Batman- und Robin-Aufsteller) neu zu präsentieren und so nachgewachsenen Leserinnen- und Lesergenerationen nahezubringen. Es handelt sich um einen vollfarbigen, handgeletterten Softcover-Band im bewährten Heftchenformat, der dem 1998 verstorbenen Batman-Erfinder Bob Kane gewidmet ist.
Im Vorwort geht Adam West, der Schauspieler also, der Batman in der komödiantischen Fernsehserie von 1966 bis 1968 und im Spielfilm aus dem Jahre 1966 verkörperte, auf eben jene Serie ein und schreibt, dass die Batman-Comics jenes Jahrzehnts die Hauptinspirationsquelle für die Serie gewesen seien. In dieser war Batman alles andere als düster. Dies ist ein Hinweis darauf, dass es die damaligen Comics ebenfalls noch nicht waren bzw. dass sie zumindest eine humoristische Lesart erlaubten. Näher ins Detail geht die Infoseite „Batmans ,New Look‘“, die von der Neuausrichtung unter Redakteur Julius Schwartz im Jahre 1964 berichtet, der Batman wieder zu einem bodenständigen detektivischen Helden gemacht und den Science-Fiction-Anteil ebenso wie die Superschurken stark zurückfahren hatte. Als zwei Jahre später die TV-Serie ausgestrahlt und ein Riesenerfolg wurde, habe man sich jedoch stark an ihr orientiert. Die Serienmacher orientierten sich also an den Comics, die sich daraufhin an der TV-Serie orientierten: Ein schönes Beispiel für die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Medienformen.
Die erste Geschichte lautet „Kriminelle Komödien des Jokers!“ und stammt aus dem Juli 1964. Adam Wests genannte Inspiration wird hier verständlich, handelt es sich doch um eine komödiantische Story mit dem Joker als Antagonist, die man sich gut auch als Serienepisode hätte vorstellen können, die aber zugleich eine schöne Hommage an die Humoristen der Stummfilm-Ära darstellt. Der obszöne Reichtum des Opfers indes wird nicht problematisiert.
Auf eine Seite mit Batman- und Robin-Zeichenskizzen folgen „Die rätsellosen Raubzüge des Riddlers“ aus dem März 1966, eine großartige Geschichte um den mit seinem innere Zwang , Batman und Robin ständig Rätsel im Zusammenhang mit seinen Verbrechen stellen und damit Hinweise geben zu müssen, ringenden Schurken. Er versucht hier, sich selbst davon zu heilen. Das ist spannend und verfügt tatsächlich bereits über so etwas wie psychologischen Tiefgang – wenn auch noch arg abstrahiert, dafür nicht so albern, und wirft die Frage auf: Sind die Bekloppten, die einem im Alltag immer mal wieder über den Weg laufen, am Ende nicht vielleicht Hinweisgeber auf jemanden vom Schlage eines Riddlers?
Die Infoseite „Die Schurken der 60er, Teil 1“ proträtiert in Kurzform den Joker, den Riddler und Blockbuster, der im November 1965 eingeführt wurde und nun in „Blockbuster schlägt wieder zu!“ aus dem März 1966 zum Zuge kommt. Diese Geschichte wartet mit einer Rückblende in die Origin-Story des Blockbusters und als einen spektakulären Höhepunkt die Demaskierung Batmans vor dem Gegner auf. Es stellt sich heraus, dass der geheimnisvolle Outsider involviert ist, den man nicht bzw. nur in Form seines Schattens zu Gesicht bekommt und der der Geschichte einen düsteren Touch verleiht. Ein Infokasten nach dem letzten Panel enthält Hintergrundinformationen zu dieser 1964 eingeführten Figur, wurde aber leider nicht ins Deutsche übersetzt – weshalb auch immer.
Nachdem man sich auf einer weiteren Infoseite über die Batmobile der sechziger Jahre schlaumachen konnte, geht es mit Poison Ivys Origin-Story „Die Küsse von Poison Ivy!“ aus dem Juni 1966 weiter, die ein Stück weit auch eine Hommage an die Femmes fatales des Film noir bzw. entsprechender Kriminalbelletristik ist. Die Texte und Ideen sind grandios: Man verguckt sich ineinander, Ivy gleich sowohl in Bruce Wayne als auch in Batman, erstmals zieht sich Wayne öffentlich in Batman um und sogar drei ältere Schurkinnen werden involviert, als Ivy sich derer Eitelkeit zunutze macht, um sie gegeneinander auszuspielen. Da macht sich Robin zurecht Sorgen, dass Batman ihr verfallen könnte. Sexy und ein toller Einstand!
Wir bleiben bei Frauen-Power: „Batgirl teilt das dynamische Duo!“ aus dem November 1967 hat diverse blumige Umschreibungen für Barbara Gordon alias Batgirl parat, von der „maskierten Maid“ über die „schwingentragende Schönheit“ bin zur „schönen Schurkenjägerin“ und zeigt einen geschwächten Batman, der sich mit Sumpffieber infiziert hat. Batgirl wird daher zu seiner Beschützerin, ohne dass er davon weiß, wodurch es aber zu einem für alle Beteiligten belastenden Gezerre um Robin kommt. Eine etwas arg konstruierte Geschichte, die sich aber inhaltsschwanger um Themen wie Loyalität, Eifersucht und Loslassen dreht – und um Batgirls Moped-Widget, den spektakulären Spektrographlichtpfeilstrahl! Die Story endet mit einem vielversprechenden Cliffhanger in Bezug auf Catwoman…
„Die Schurken der 60er, Teil 2“ porträtiert Poison Ivy, Scarecrow und den Pinguin, woraufhin der Zweitgenannte in „In der Hand des Schreckens!“ aus dem März 1968 seinen großen Auftritt bekommt. Die Geschichte um Scarecrows Furchterzeugungspille tendiert gen Horror, nebenbei werden Batmans und Robins Origin-Storys eingeflochten. Robin wird als „titanischer Teenager“ alliteriert und neben Scarecrow geben sich zahlreiche weitere Schurken ein Stelldichein. Das Finale fällt deftig aus, von Klamauk keine Spur. Offen bleibt nur, wie zur Hölle diese Pille funktioniert. Eventuell wurde diese Geschichte nicht ganz zu Ende gedacht…? „Überraschung! Du bist tot!“ heißt es anschließend für Batgirl („die schattenhafte Schönheit“) in dieser Geschichte aus dem Juni 1969. Es geht um Mummenschanz und Verwechslungen, um Menschen in Superheldenkostümen, die meisten davon Verbrecher…
„Eine Kugel zuviel!“ aus dem Dezember 1969 bedeutet eine Zäsur: Robin verlässt Wayne Manor, um aufs College zu gehen, woraufhin Bruce mit Diener Alfred ins Zentrum Gothams umzieht. Diese Geschichte markiert die Wiedergeburt des realistischeren Stils und die Einzug haltende Sozialkritik in die Batman-Welt. Die Wayne-Stiftung wird ins Leben gerufen und fungiert als Opferschutz- und -hilfsorganisation. „Eine Kugel zuviel!“ mit ihrem seltsam offenen Ende steht stellvertretend für das nach dem Ende der TV-Serie reaktivierte, bereits zuvor von Schwartz intendierte Konzept, Geschichten ohne Superschurken, dafür einfacheren Gangstern zu entwickeln (worüber die vorangestellte Infoseite „Die Rückkehr zum dunklen Ritter“ in Kenntnis setzt). Diese Art von Batman-Geschichten dominierte dann offenbar eine Weile die Comicreihe, bis man irgendwann in den 1970ern zur von mir favorisierten Kombination aus Realismus, sozialem Gewissen und psychopathischen Überschurken überging, bis es wiederum Mitte der 1980er zur „Crisis on Infinite Earths“ kam und das gesamte DC-Universum quasi neu geschrieben werden musste.
Auch die Erläuterungen am Ende dieser letzten Geschichte des Bands wurden leider nicht übersetzt. Bei den sporadisch auftretenden Werbeanzeigen bin ich hingegen froh darüber, dass sie jeweils im Original belassen und nicht durch Dino-verlagseigene Anzeigen ersetzt wurden. Eigenartig ist jedoch, dass man orthographisch eigentlich voll auf der Höhe ist, die letzte Seite mit den Zeichner-Kurzporträts aber offenbar am Lektorat vorbei ins Buch fand. Das ist etwas schade für einen ansonsten überaus gelungenen Sonderband, der neben viel Comic-Geschichtsunterricht auch überaus lesenswerte Geschichten aus einer längst vergangenen Dekade kompiliert, von denen es viele zuvor nie nach Deutschland geschafft haben dürften. Bemerkenswert sind auch ihre jeweiligen Establishing Shots, die i.d.R. herrlich reißerisch suggerieren, dass eigentlich alles aus sei.
Dieser Band wird sich gut in meinem Regal zwischen den Zusammenstellungen noch älterer Batman-Comics und meiner geliebten Sammlung jener genannten ‘70er- und ‘80er-Ausgaben machen.
 Als ich dieses rund 200-seitige Softcover-Album aus der Carlsen-Qualitätscomicschmiede in einer Wühlkiste auf der Comic- und Manga-Convention in der Hamburger Fabrik entdeckte, fühlte ich mich wohlig an meine Kindheit erinnert, als ich mich immer freute, ein extradickes Ferien-Comicsonderheft auf dem Flohmarkt zu finden und es genüsslich während des Sommers zu verschlingen. Also sackte ich den im Mai 1996 veröffentlichten, vollfarbigen, auf mattem Qualitätspapier gedruckten Wälzer ein und vergrub mich auf meinem Urlaubsflug nach Mallorca darin.
Als ich dieses rund 200-seitige Softcover-Album aus der Carlsen-Qualitätscomicschmiede in einer Wühlkiste auf der Comic- und Manga-Convention in der Hamburger Fabrik entdeckte, fühlte ich mich wohlig an meine Kindheit erinnert, als ich mich immer freute, ein extradickes Ferien-Comicsonderheft auf dem Flohmarkt zu finden und es genüsslich während des Sommers zu verschlingen. Also sackte ich den im Mai 1996 veröffentlichten, vollfarbigen, auf mattem Qualitätspapier gedruckten Wälzer ein und vergrub mich auf meinem Urlaubsflug nach Mallorca darin.
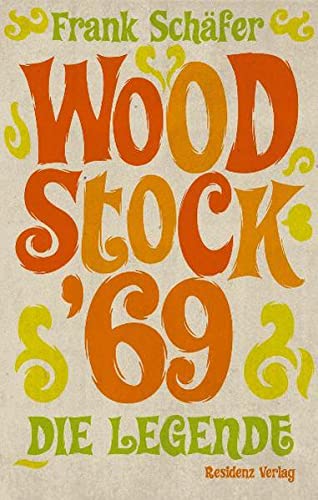 Der Braunschweiger Frank Schäfer, Autor zahlreicher Veröffentlichungen aus den Bereichen Literatur- und Musikkritik, Populär- und Subkultur sowie autobiographisch geprägter Romane, machte sich mit dem im Jahre 2009 im österreichischen Residenz-Verlag veröffentlichten „Woodstock ‘69“ daran, ein ganz dickes Brett zu bohren: eine sich über rund 200 Taschenbuchseiten erstreckende Rekonstruktion des legendären Hippiefestivals, die sich auf eine beachtliche Zahl an Quellen stützt. Natürlich war der 1966 geborene Schäfer seinerzeit nicht selbst vor Ort. Dank seiner akribischen Quellenauswertung liest sich das in fünf Hauptkapitel unterteilte Buch jedoch mitunter, als sei er es gewesen.
Der Braunschweiger Frank Schäfer, Autor zahlreicher Veröffentlichungen aus den Bereichen Literatur- und Musikkritik, Populär- und Subkultur sowie autobiographisch geprägter Romane, machte sich mit dem im Jahre 2009 im österreichischen Residenz-Verlag veröffentlichten „Woodstock ‘69“ daran, ein ganz dickes Brett zu bohren: eine sich über rund 200 Taschenbuchseiten erstreckende Rekonstruktion des legendären Hippiefestivals, die sich auf eine beachtliche Zahl an Quellen stützt. Natürlich war der 1966 geborene Schäfer seinerzeit nicht selbst vor Ort. Dank seiner akribischen Quellenauswertung liest sich das in fünf Hauptkapitel unterteilte Buch jedoch mitunter, als sei er es gewesen.
 Dieses 116-seitige broschierte Buch auf hochwertigem, festem Papier habe ich vor einiger Zeit aus einer „Zu verschenken“-Kiste am Straßenrand gefischt. Da ich selbst VHS-Bänder aufbewahre, hatte es mein Interesse geweckt. Herausgegeben wurde der sämtliche Inhalte in einer deutschen und einer englischen Fassung enthaltende, dadurch zweispaltig gestaltete Sammelband vom Kunstmuseum Wolfsburg im Jahre 1997. Anlass war das dessen Videosymposium am 25. November 1995. Aufgeteilt in neun Kapitel plus zwei Vorworte und ein paar Begleitinformationen wird der Begriff „audiovisuelle Kunstwerke“ dahingehend verengt, dass es vornehmlich um Videoinstallationen in Ausstellungen geht, weniger um z.B. fiktionale Spielfilme und Serien auf Videobändern. Anlass des Symposiums war die Ausstellung „High-Tech-Allergy“ des Künstlers Paik; abgedruckt sind die Vorträge verschiedener Referentinnen und Referenten jener Tagung sowie ein Interview mit Paik.
Dieses 116-seitige broschierte Buch auf hochwertigem, festem Papier habe ich vor einiger Zeit aus einer „Zu verschenken“-Kiste am Straßenrand gefischt. Da ich selbst VHS-Bänder aufbewahre, hatte es mein Interesse geweckt. Herausgegeben wurde der sämtliche Inhalte in einer deutschen und einer englischen Fassung enthaltende, dadurch zweispaltig gestaltete Sammelband vom Kunstmuseum Wolfsburg im Jahre 1997. Anlass war das dessen Videosymposium am 25. November 1995. Aufgeteilt in neun Kapitel plus zwei Vorworte und ein paar Begleitinformationen wird der Begriff „audiovisuelle Kunstwerke“ dahingehend verengt, dass es vornehmlich um Videoinstallationen in Ausstellungen geht, weniger um z.B. fiktionale Spielfilme und Serien auf Videobändern. Anlass des Symposiums war die Ausstellung „High-Tech-Allergy“ des Künstlers Paik; abgedruckt sind die Vorträge verschiedener Referentinnen und Referenten jener Tagung sowie ein Interview mit Paik. Eine der faszinierendsten (Super-)Helden-Comic-Reihen ist seit jeher Batman, gerade weil er über gar keine Superkräfte verfügt. Von DC im Jahre 1939 erstmals ins Rennen geschickt, durchlebte der dunkle Ritter zahlreiche Metamorphosen, Spin-Offs und Reboots. Im Jahre 1999, also zum sechzigjährigen Jubiläum, stellte der deutsche Dino-Verlag für diesen Sonderband besonders relevante oder herausragende Batman-Comics aus den 1960ern zusammen, um sie auf rund 150 Seiten angereichert mit zahlreichen Hintergrundinformationen und einem eingehefteten Bastelbogen (für je einen Batman- und Robin-Aufsteller) neu zu präsentieren und so nachgewachsenen Leserinnen- und Lesergenerationen nahezubringen. Es handelt sich um einen vollfarbigen, handgeletterten Softcover-Band im bewährten Heftchenformat, der dem 1998 verstorbenen Batman-Erfinder Bob Kane gewidmet ist.
Eine der faszinierendsten (Super-)Helden-Comic-Reihen ist seit jeher Batman, gerade weil er über gar keine Superkräfte verfügt. Von DC im Jahre 1939 erstmals ins Rennen geschickt, durchlebte der dunkle Ritter zahlreiche Metamorphosen, Spin-Offs und Reboots. Im Jahre 1999, also zum sechzigjährigen Jubiläum, stellte der deutsche Dino-Verlag für diesen Sonderband besonders relevante oder herausragende Batman-Comics aus den 1960ern zusammen, um sie auf rund 150 Seiten angereichert mit zahlreichen Hintergrundinformationen und einem eingehefteten Bastelbogen (für je einen Batman- und Robin-Aufsteller) neu zu präsentieren und so nachgewachsenen Leserinnen- und Lesergenerationen nahezubringen. Es handelt sich um einen vollfarbigen, handgeletterten Softcover-Band im bewährten Heftchenformat, der dem 1998 verstorbenen Batman-Erfinder Bob Kane gewidmet ist.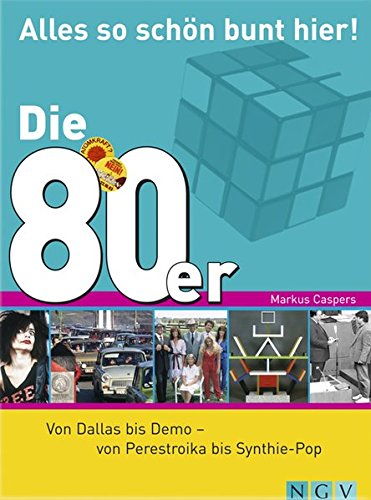 Noch vor der großen ‘80er-Jahre-Retrowelle, genauer: im Jahre 2007 veröffentlichte der Kölner Verlag Naumann & Göbel (NGV) Markus Caspers gebundenen großformatigen und kommentierten Bildband mit abwischbarer Oberfläche und auf festem, hochwertigem Papier: Rund 260 Seiten stark, mit über 400 Bildern. Böse Zungen behaupten, die ‘80er hätten auch eine abwischbare Oberfläche gehabt, verkennen dabei aber, dass unterkühlte Neo-noir-Ästhetik und synthetische Musik Ausdruck eines Zeitgeists und eines Lebensgefühls waren (und sind), das sich aus verschiedenen Faktoren zusammensetzte und entwickelte – und gern an konformistischen, konsumorientierteren Oberflächlichkeiten kratzte.
Noch vor der großen ‘80er-Jahre-Retrowelle, genauer: im Jahre 2007 veröffentlichte der Kölner Verlag Naumann & Göbel (NGV) Markus Caspers gebundenen großformatigen und kommentierten Bildband mit abwischbarer Oberfläche und auf festem, hochwertigem Papier: Rund 260 Seiten stark, mit über 400 Bildern. Böse Zungen behaupten, die ‘80er hätten auch eine abwischbare Oberfläche gehabt, verkennen dabei aber, dass unterkühlte Neo-noir-Ästhetik und synthetische Musik Ausdruck eines Zeitgeists und eines Lebensgefühls waren (und sind), das sich aus verschiedenen Faktoren zusammensetzte und entwickelte – und gern an konformistischen, konsumorientierteren Oberflächlichkeiten kratzte. Nach dem
Nach dem  Bevor die Renaissance der Popkultur des 1980er-Dezenniums in den 2010er-Jahren erfolgreich vollzogen wurde, gab es in der ersten Hälfe der 2000er bereits Unternehmungen in diese Richtung. Spielzeughersteller Mattel legte die „Masters of the Universe“-Actionfiguren wieder auf und gab sogar eine neue Zeichentrickserie in Auftrag, Modern Talking waren bedauerlicherweise bereits seit 1998 (bis 2003) wieder aktiv, Iron Maiden brachten mit ihrer Reunion den klassischen Heavy Metal der ‘80er international weit über den Underground hinaus zurück aufs Tapet, Nena feierte mit Neuaufnahmen alter Hits ihr 20-jähriges Jubiläum, No Doubt beherrschten mit ihrer Talk-Talk-Coverversion „It’s My Life“ die Charts – und der Kölner Privatsender RTL, selbst eine Geburt der ‘80er, ließ von Günther Jauch, einem Unterhaltungssendungsmoderator, der in den 1980ern seine Popularität erlangte, die mehrteilige „80er Show“ produzieren. Diese wirkte etwas bemüht, als gelte es, ein Revival zu erzwingen, und war schlicht ungefähr zehn Jahre zu früh dran.
Bevor die Renaissance der Popkultur des 1980er-Dezenniums in den 2010er-Jahren erfolgreich vollzogen wurde, gab es in der ersten Hälfe der 2000er bereits Unternehmungen in diese Richtung. Spielzeughersteller Mattel legte die „Masters of the Universe“-Actionfiguren wieder auf und gab sogar eine neue Zeichentrickserie in Auftrag, Modern Talking waren bedauerlicherweise bereits seit 1998 (bis 2003) wieder aktiv, Iron Maiden brachten mit ihrer Reunion den klassischen Heavy Metal der ‘80er international weit über den Underground hinaus zurück aufs Tapet, Nena feierte mit Neuaufnahmen alter Hits ihr 20-jähriges Jubiläum, No Doubt beherrschten mit ihrer Talk-Talk-Coverversion „It’s My Life“ die Charts – und der Kölner Privatsender RTL, selbst eine Geburt der ‘80er, ließ von Günther Jauch, einem Unterhaltungssendungsmoderator, der in den 1980ern seine Popularität erlangte, die mehrteilige „80er Show“ produzieren. Diese wirkte etwas bemüht, als gelte es, ein Revival zu erzwingen, und war schlicht ungefähr zehn Jahre zu früh dran. „Alles, was Sie noch nie über Sex wissen wollten und deshalb auch keine Lust hatten, danach zu fragen“, heißt es noch auf dem Cover. Texter Larry Siegel hatte bereits für das neunte Mad-Taschenbuch mit George Woodbridge zusammengearbeitet; diesmal steht ihm stattdessen Zeichner Angelo Torres zur Seite, der in der Nr. 25 mit Tom Koch „Das Mad-Buch der Weltgeschichte“ zu Papier gebracht hatte.
„Alles, was Sie noch nie über Sex wissen wollten und deshalb auch keine Lust hatten, danach zu fragen“, heißt es noch auf dem Cover. Texter Larry Siegel hatte bereits für das neunte Mad-Taschenbuch mit George Woodbridge zusammengearbeitet; diesmal steht ihm stattdessen Zeichner Angelo Torres zur Seite, der in der Nr. 25 mit Tom Koch „Das Mad-Buch der Weltgeschichte“ zu Papier gebracht hatte.