 Das Thema Schule ist ein Dankbares, denn fast jeder war selbst auf einer und ist somit irgendwie mit dem Thema vertraut, erlaubt sich häufig auch Meinungen, und vergleicht seine eigene Schulzeit mit aktuellen Berichten – gerade auch kritischen, Stichwörter „Pisa-Studie“, „Bildungsmisere“, „Rütli-Schule“ -, meist spätestens dann, wenn der eigene Nachwuchs da ist. So stieß auch ich auf Bücher, die sich auf sehr amüsante Weise mit dem aktuellen Schulalltag auseinandersetzen, ob aus Schüler- oder aus Lehrersicht. Besonders Lehrkörper Stephan Serin hatte es mir mit seinen herrlich selbstironischen Bänden „Föhn mich nicht zu“ und „Musstu wissen, weißdu!“ angetan und mich einerseits zu wahren Lachanfällen animiert, mir andererseits aber auch aktuelle Bildungsprobleme vermittelt und zum Nachdenken angeregt. Vor diesem Hintergrund stieß ich kürzlich beim Stöbern in einer Buchhandlung auf „Isch geh Schulhof“ von Philipp Möller, der aus der Erwachsenen-Pädagogik kommt und als Quereinsteiger an einer Grundschule in einem Berliner Kiez landete. Im Gegensatz zum bewusst überzeichneten und komödiantischen Stil Serins vergewissert Möller, dass es bei ihm keinen Unterschied zwischen Erzähler und Autor gäbe, also bis auf die Namen sich alles tatsächlich so abgespielt habe. Und was er nach seinem Sprung ins kalte Wasser zu berichten weiß, ist wahrlich haarsträubend. Seine Schule in einem sog. Problembezirk befindet sich in einem desolaten Zustand und das Bildungsniveau ist erschreckend niedrig. Die zusammengewürfelten Klassen mit Schülern unterschiedlicher Herkunft (bzw. mit Schülern mit Eltern unterschiedlicher Nationalitäten) hinken sämtlichen Lehrplänen hinterher; an normalen Unterricht ist kaum zu denken, denn zunächst einmal müssen die grundlegendsten Benimmregeln vermittelt und die Sprachbarrieren überwunden werden, von ethischen Selbstverständlichkeiten einmal ganz zu schweigen. Möller beschreibt sehr anschaulich die Herausforderungen, vor die er sich gestellt sah und die Probleme nicht nur seiner Schule, sondern im Prinzip des derzeitigen Bildungssystems, adäquat auf diese geänderten Anforderungen zu reagieren. So bekommt der Leser einen sehr praxisorientierten, sicherlich auch stark vereinfachten, aber eben auch veranschaulichenden Einblick in reformistische Ansätze und ihren Sinn. Gleichzeitig entwickelt der Leser ein Bewusstsein – sofern noch nicht vorhanden – für die Ursachen der Lernschwächen und sozialen Inkompetenz von „Problemschülern“, wie sie „Herrn Mülla“ konfrontieren. Diese Abschnitte trafen besonders meinen Nerv, denn frei jeglichen dann unangebrachten Humors und Zynismus scheut er sich weder, mit dem Migrationshintergrund manch Schülers offenbar verbundene Gründe zu benennen, noch xenophoben Ressentiments die Zähne zu ziehen, indem er allgemeine soziale Missstände und Versäumnisse sowie Ungerechtigkeiten des Systems aufzeigt. Ansonsten regiert aber auch gern mal der, bisweilen auch etwas derbere, (Galgen-)Humor, wenn auch weit weniger als beispielsweise in Serins o.g. Büchern. Möller beschreibt darüber hinaus seine Versuche, sich nach anfänglicher Skepsis mit den Gegebenheiten zu arrangieren und seine Arbeit so gut wie möglich zu machen, seine Erfolge, aber auch seine Rückschläge – und seine vermutlich oft als Kampf gegen Windmühlen empfundenen Erfahrungen mit demotivierten bis unfähigen Kolleginnen und Kollegen, den Behörden etc. Auf den Verwaltungsapparat wird kein sonderlich gutes Licht geworfen, wenn man liest, wie einerseits Quereinsteiger ohne jegliche Erfahrung auf die (bzw. vor allem diese) Kinder losgelassen werden, wodurch der Sinn des Lehramtsstudiums natürlich angezweifelt werden darf, und andererseits diese im Idealfall dann motivierten, frischen Nachwuchskräfte schließlich geschasst werden, nachdem sie glaubten, ihre Berufung gefunden zu haben. „Hire & Fire“ im Bildungsbereich – unfassbar und wenig zielführend. Dadurch mutet „Isch geh Schulhof“ bisweilen auch etwas wie eine Abrechnung mit dem starren und ignoranten Schulapparat an, was sich jedoch im akzeptablen und vor allem verständlichen Rahmen hält. Aus seinem antiklerikalen, liberalen/sozialen und freidenkerischen Weltbild macht Möller keinen Hehl und erteilt falscher Toleranz (nämlich der ggü. Intoleranz) klare Absagen, ohne zum verweichlichten Gutmenschen zu werden – ganz im Gegenteil, er legt sich ein erstaunlich dickes Fell zu. All dies natürlich vorausgesetzt dem Fall, dass es Möller mit der Wahrheit hier tatsächlich immer ganz genau nahm. Als störend erweist sich nämlich gerade auch hin und wieder seine Selbstgefälligkeit, nicht selten scheint er sich selbst auf die Schulter zu klopfen und vermischt seine beruflichen und pädagogischen Erfahrungen zudem mit Einblicken in sein Privatleben und seine Sozialisation, und beide erscheinen fast schon befremdlich harmonisch und perfekt, als habe er nie etwas auszustehen gehabt. Tatsächlich entstammt er dem Bildungsbürgertum der Mittelschicht, einer klassischen Lehrerfamilie, und das Schicksal scheint es stets gut mit ihm gemeint zu haben. Jedoch ist sich Möller dessen anscheinend bewusst und zieht in entscheidenden Fragen meines Erachtens meist die richtigen Schlüsse – beispielsweise den, dass ein Buch wie dieses ein durchaus sinnvoller und niedrigschwelliger Beitrag zur Debatte um das Schulsystem und die Bildungspolitik sein kann, und quasi nebenbei eine persönliche Aufarbeitung turbulenter Jahre – oder umgekehrt. Mich hat das Buch jedenfalls gut unterhalten, beginnend auf „Asi-TV-Niveau“, jedoch lediglich, um sein Publikum dort abzuholen und mit ihm gemeinsam hinter die Kulissen zu blicken, Missstände anzuprangern, Widersprüche aufzuzeigen und auszuhalten und Lösungsansätze zu liefern. Dass er dabei, besonders gegen Ende, wie unter Zeitdruck stehend auch noch arg oberflächlich und hektisch Psychologie und Philosophie einbringt, möchte ich seinem Komplettierungseifer zuschreiben und sei ihm verziehen. Seine Selbstgefälligkeit an der Schwelle zur Arroganz wiederum mag – immer noch unter der Prämisse, dass sich tatsächlich alles so wie beschrieben abgespielt hat – seinen ungeahnten und respektablen Erfolgen zuzuschreiben sein, die er unter diesen schwierigen Bedingungen an jener Schule erreicht hat und ihn zunächst sicherlich um Jahre altern lassen, schließlich jedoch klüger und weiser gemacht haben, geschuldet sein, doch so sehr man sich auch darüber freuen darf, über sich selbst hinausgewachsen zu sein, so wäre doch gerade angesichts derart trauriger Schicksale wie derjenigen, derer sich Möller in Form seiner Schüler ausgesetzt sah, etwas Demut angebracht, statt mit seinem intakten Bilderbuch-Familienleben anzugeben. Dies war zumindest mein Empfinden. Kritiker behaupten, Möller habe sich am Erfolg der unter dem Pseudonym „Frau Freitag“ veröffentlichten Blog-Einträge und Bücher zum ähnlichen Thema stark und wenig originell orientiert, was ich nicht beurteilen kann, da ich diese noch nicht kenne – aber gern als Empfehlung mitnehme.
Das Thema Schule ist ein Dankbares, denn fast jeder war selbst auf einer und ist somit irgendwie mit dem Thema vertraut, erlaubt sich häufig auch Meinungen, und vergleicht seine eigene Schulzeit mit aktuellen Berichten – gerade auch kritischen, Stichwörter „Pisa-Studie“, „Bildungsmisere“, „Rütli-Schule“ -, meist spätestens dann, wenn der eigene Nachwuchs da ist. So stieß auch ich auf Bücher, die sich auf sehr amüsante Weise mit dem aktuellen Schulalltag auseinandersetzen, ob aus Schüler- oder aus Lehrersicht. Besonders Lehrkörper Stephan Serin hatte es mir mit seinen herrlich selbstironischen Bänden „Föhn mich nicht zu“ und „Musstu wissen, weißdu!“ angetan und mich einerseits zu wahren Lachanfällen animiert, mir andererseits aber auch aktuelle Bildungsprobleme vermittelt und zum Nachdenken angeregt. Vor diesem Hintergrund stieß ich kürzlich beim Stöbern in einer Buchhandlung auf „Isch geh Schulhof“ von Philipp Möller, der aus der Erwachsenen-Pädagogik kommt und als Quereinsteiger an einer Grundschule in einem Berliner Kiez landete. Im Gegensatz zum bewusst überzeichneten und komödiantischen Stil Serins vergewissert Möller, dass es bei ihm keinen Unterschied zwischen Erzähler und Autor gäbe, also bis auf die Namen sich alles tatsächlich so abgespielt habe. Und was er nach seinem Sprung ins kalte Wasser zu berichten weiß, ist wahrlich haarsträubend. Seine Schule in einem sog. Problembezirk befindet sich in einem desolaten Zustand und das Bildungsniveau ist erschreckend niedrig. Die zusammengewürfelten Klassen mit Schülern unterschiedlicher Herkunft (bzw. mit Schülern mit Eltern unterschiedlicher Nationalitäten) hinken sämtlichen Lehrplänen hinterher; an normalen Unterricht ist kaum zu denken, denn zunächst einmal müssen die grundlegendsten Benimmregeln vermittelt und die Sprachbarrieren überwunden werden, von ethischen Selbstverständlichkeiten einmal ganz zu schweigen. Möller beschreibt sehr anschaulich die Herausforderungen, vor die er sich gestellt sah und die Probleme nicht nur seiner Schule, sondern im Prinzip des derzeitigen Bildungssystems, adäquat auf diese geänderten Anforderungen zu reagieren. So bekommt der Leser einen sehr praxisorientierten, sicherlich auch stark vereinfachten, aber eben auch veranschaulichenden Einblick in reformistische Ansätze und ihren Sinn. Gleichzeitig entwickelt der Leser ein Bewusstsein – sofern noch nicht vorhanden – für die Ursachen der Lernschwächen und sozialen Inkompetenz von „Problemschülern“, wie sie „Herrn Mülla“ konfrontieren. Diese Abschnitte trafen besonders meinen Nerv, denn frei jeglichen dann unangebrachten Humors und Zynismus scheut er sich weder, mit dem Migrationshintergrund manch Schülers offenbar verbundene Gründe zu benennen, noch xenophoben Ressentiments die Zähne zu ziehen, indem er allgemeine soziale Missstände und Versäumnisse sowie Ungerechtigkeiten des Systems aufzeigt. Ansonsten regiert aber auch gern mal der, bisweilen auch etwas derbere, (Galgen-)Humor, wenn auch weit weniger als beispielsweise in Serins o.g. Büchern. Möller beschreibt darüber hinaus seine Versuche, sich nach anfänglicher Skepsis mit den Gegebenheiten zu arrangieren und seine Arbeit so gut wie möglich zu machen, seine Erfolge, aber auch seine Rückschläge – und seine vermutlich oft als Kampf gegen Windmühlen empfundenen Erfahrungen mit demotivierten bis unfähigen Kolleginnen und Kollegen, den Behörden etc. Auf den Verwaltungsapparat wird kein sonderlich gutes Licht geworfen, wenn man liest, wie einerseits Quereinsteiger ohne jegliche Erfahrung auf die (bzw. vor allem diese) Kinder losgelassen werden, wodurch der Sinn des Lehramtsstudiums natürlich angezweifelt werden darf, und andererseits diese im Idealfall dann motivierten, frischen Nachwuchskräfte schließlich geschasst werden, nachdem sie glaubten, ihre Berufung gefunden zu haben. „Hire & Fire“ im Bildungsbereich – unfassbar und wenig zielführend. Dadurch mutet „Isch geh Schulhof“ bisweilen auch etwas wie eine Abrechnung mit dem starren und ignoranten Schulapparat an, was sich jedoch im akzeptablen und vor allem verständlichen Rahmen hält. Aus seinem antiklerikalen, liberalen/sozialen und freidenkerischen Weltbild macht Möller keinen Hehl und erteilt falscher Toleranz (nämlich der ggü. Intoleranz) klare Absagen, ohne zum verweichlichten Gutmenschen zu werden – ganz im Gegenteil, er legt sich ein erstaunlich dickes Fell zu. All dies natürlich vorausgesetzt dem Fall, dass es Möller mit der Wahrheit hier tatsächlich immer ganz genau nahm. Als störend erweist sich nämlich gerade auch hin und wieder seine Selbstgefälligkeit, nicht selten scheint er sich selbst auf die Schulter zu klopfen und vermischt seine beruflichen und pädagogischen Erfahrungen zudem mit Einblicken in sein Privatleben und seine Sozialisation, und beide erscheinen fast schon befremdlich harmonisch und perfekt, als habe er nie etwas auszustehen gehabt. Tatsächlich entstammt er dem Bildungsbürgertum der Mittelschicht, einer klassischen Lehrerfamilie, und das Schicksal scheint es stets gut mit ihm gemeint zu haben. Jedoch ist sich Möller dessen anscheinend bewusst und zieht in entscheidenden Fragen meines Erachtens meist die richtigen Schlüsse – beispielsweise den, dass ein Buch wie dieses ein durchaus sinnvoller und niedrigschwelliger Beitrag zur Debatte um das Schulsystem und die Bildungspolitik sein kann, und quasi nebenbei eine persönliche Aufarbeitung turbulenter Jahre – oder umgekehrt. Mich hat das Buch jedenfalls gut unterhalten, beginnend auf „Asi-TV-Niveau“, jedoch lediglich, um sein Publikum dort abzuholen und mit ihm gemeinsam hinter die Kulissen zu blicken, Missstände anzuprangern, Widersprüche aufzuzeigen und auszuhalten und Lösungsansätze zu liefern. Dass er dabei, besonders gegen Ende, wie unter Zeitdruck stehend auch noch arg oberflächlich und hektisch Psychologie und Philosophie einbringt, möchte ich seinem Komplettierungseifer zuschreiben und sei ihm verziehen. Seine Selbstgefälligkeit an der Schwelle zur Arroganz wiederum mag – immer noch unter der Prämisse, dass sich tatsächlich alles so wie beschrieben abgespielt hat – seinen ungeahnten und respektablen Erfolgen zuzuschreiben sein, die er unter diesen schwierigen Bedingungen an jener Schule erreicht hat und ihn zunächst sicherlich um Jahre altern lassen, schließlich jedoch klüger und weiser gemacht haben, geschuldet sein, doch so sehr man sich auch darüber freuen darf, über sich selbst hinausgewachsen zu sein, so wäre doch gerade angesichts derart trauriger Schicksale wie derjenigen, derer sich Möller in Form seiner Schüler ausgesetzt sah, etwas Demut angebracht, statt mit seinem intakten Bilderbuch-Familienleben anzugeben. Dies war zumindest mein Empfinden. Kritiker behaupten, Möller habe sich am Erfolg der unter dem Pseudonym „Frau Freitag“ veröffentlichten Blog-Einträge und Bücher zum ähnlichen Thema stark und wenig originell orientiert, was ich nicht beurteilen kann, da ich diese noch nicht kenne – aber gern als Empfehlung mitnehme.
 Dr. phil. Frank Schäfer ist nicht nur Musikjournalist und Autor sich immer wieder gern anekdotenhaft mit Hardrock und Heavy Metal auseinandersetzender Werke, sondern auch ein hervorragender Beobachter mit Sinn für Details, der in immer irgendwie autobiographisch wirkenden Geschichten und Geschichtchen den vermeintlich unbedeutenden Kleinigkeiten ebensoviel Platz einzuräumen scheint wie dem Spektakuläreren. Die 2003 im Oktober-Verlag veröffentlichte, rund 170-seitige und in neun Kapitel bzw. Abschnitte unterteilte Sammlung von Beziehungskisten und Alltagsbeobachtungen, von melancholischen Erinnerungen und auch mal witziger Situationskomik, der er den Titel „Verdreht“ vergab, erzählt vornehmlich von einer Jugendparty mit einem Schwerverletzten und später von einem Klassentreffen gealterter Männer und Frauen, dazwischen kürzere, autarke Erinnerungen. Der besondere Kniff ist, dass Schäfer die Haupthandlung um die Party, in der es um Andreas’ Interesse für Birgit geht, immer wieder zugunsten der in ihren Inhalten davon unabhängigen Anekdoten unterbricht, aber mehr als einmal zu ihr zurückkehrt, dabei auch gern nichtchronologisch die Geschichte weiter ausarbeitet. Neben den Empfindungen des Protagonisten in einer undurchsichtigen Gemengelage seines Freundeskreises, der sehr anschaulich skizziert und charakterisiert wird, bezieht sie ihre Spannung aus der Frage, wie genau es zu dem Unfall am Pool kam, der einen jungen Mann ins Krankenhaus brachte. Geht es gegen Ende des Buchs vornehmlich um ein Klassentreffen und das Wiederaufflammen einer alten Liebe, weicht die postpubertäre Stimmung jungmännischer Verunsicherung einer gereiften Melancholie angesichts gescheiterter Lebens- bzw. Beziehungsentwürfe, die Schäfer vor dem Abgleiten in die Desillusion rettet und stattdessen Hoffnung spendet, ohne die Bedeutung jahrzehntealter Kontakte, Freundschaften und Bindungen zu relativieren. Schäfers gern eingestreute pop- und subkulturelle Verweise (Dokkens „Breaking The Chains“ anyone?!) dürfen natürlich genauso wenig fehlen wie seine Vorliebe für obskure Fremdwörter, die er glücklicherweise so gut in den Griff bekommen hat, dass ihr sporadisches Durchscheinen wie ein individuelles Stilelement wirkt, das nicht stört. „Verdreht“ liest sich schnell und gut durch, wird auch durch das Lokalkolorit niedersächsischer Provinz authentisch verortet und geerdet und verleugnet seinen vermutlich ehrlichen, bodenständigen Anspruch nie zugunsten wenig nachvollziehbarer oder erzwungen wirkender Entwicklungen zwecks fragwürdiger Aufmerksamkeitsbuhlerei – konsequenterweise bekommt somit auch nicht alles einen positiven Ausgang. Etwas schade finde ich lediglich, dass er mit „Kirschblüte“ eine Geschichte erneut abdrucken ließ, die bereits aus dem nur ein Jahr zuvor veröffentlichten „Ich bin dann mal weg – Streifzüge durch die Pop-Kultur“ bekannt war.
Dr. phil. Frank Schäfer ist nicht nur Musikjournalist und Autor sich immer wieder gern anekdotenhaft mit Hardrock und Heavy Metal auseinandersetzender Werke, sondern auch ein hervorragender Beobachter mit Sinn für Details, der in immer irgendwie autobiographisch wirkenden Geschichten und Geschichtchen den vermeintlich unbedeutenden Kleinigkeiten ebensoviel Platz einzuräumen scheint wie dem Spektakuläreren. Die 2003 im Oktober-Verlag veröffentlichte, rund 170-seitige und in neun Kapitel bzw. Abschnitte unterteilte Sammlung von Beziehungskisten und Alltagsbeobachtungen, von melancholischen Erinnerungen und auch mal witziger Situationskomik, der er den Titel „Verdreht“ vergab, erzählt vornehmlich von einer Jugendparty mit einem Schwerverletzten und später von einem Klassentreffen gealterter Männer und Frauen, dazwischen kürzere, autarke Erinnerungen. Der besondere Kniff ist, dass Schäfer die Haupthandlung um die Party, in der es um Andreas’ Interesse für Birgit geht, immer wieder zugunsten der in ihren Inhalten davon unabhängigen Anekdoten unterbricht, aber mehr als einmal zu ihr zurückkehrt, dabei auch gern nichtchronologisch die Geschichte weiter ausarbeitet. Neben den Empfindungen des Protagonisten in einer undurchsichtigen Gemengelage seines Freundeskreises, der sehr anschaulich skizziert und charakterisiert wird, bezieht sie ihre Spannung aus der Frage, wie genau es zu dem Unfall am Pool kam, der einen jungen Mann ins Krankenhaus brachte. Geht es gegen Ende des Buchs vornehmlich um ein Klassentreffen und das Wiederaufflammen einer alten Liebe, weicht die postpubertäre Stimmung jungmännischer Verunsicherung einer gereiften Melancholie angesichts gescheiterter Lebens- bzw. Beziehungsentwürfe, die Schäfer vor dem Abgleiten in die Desillusion rettet und stattdessen Hoffnung spendet, ohne die Bedeutung jahrzehntealter Kontakte, Freundschaften und Bindungen zu relativieren. Schäfers gern eingestreute pop- und subkulturelle Verweise (Dokkens „Breaking The Chains“ anyone?!) dürfen natürlich genauso wenig fehlen wie seine Vorliebe für obskure Fremdwörter, die er glücklicherweise so gut in den Griff bekommen hat, dass ihr sporadisches Durchscheinen wie ein individuelles Stilelement wirkt, das nicht stört. „Verdreht“ liest sich schnell und gut durch, wird auch durch das Lokalkolorit niedersächsischer Provinz authentisch verortet und geerdet und verleugnet seinen vermutlich ehrlichen, bodenständigen Anspruch nie zugunsten wenig nachvollziehbarer oder erzwungen wirkender Entwicklungen zwecks fragwürdiger Aufmerksamkeitsbuhlerei – konsequenterweise bekommt somit auch nicht alles einen positiven Ausgang. Etwas schade finde ich lediglich, dass er mit „Kirschblüte“ eine Geschichte erneut abdrucken ließ, die bereits aus dem nur ein Jahr zuvor veröffentlichten „Ich bin dann mal weg – Streifzüge durch die Pop-Kultur“ bekannt war.
 Menschen, die über ein Mindestmaß an Empfindsamkeit verfügen, neigen dazu, prägende Lebensabschnitte oder -ereignisse mit Songs in Verbindung zu bringen. Diese müssen inhaltlich gar nicht einmal zwingend dazu passen, sondern einfach zu jener Zeit präsent gewesen zu sein – ob bewusst oder unbewusst ausgewählt oder ohne eigenes Zutun dank medialer Omnipräsenz. Ertönt Jahre später solch ein Lied, ist sofort die Erinnerung oder ein bestimmtes Gefühl wie aus dem Nichts wieder wach. Es wird schwierig, einen solchen Song wieder anders im Unterbewusstsein zu verknüpfen, aber i.d.R. will man das auch gar nicht, schwelgt stattdessen in süßer oder bitterer Melancholie. Einer Reihe Beispiele für dieses Phänomen widmet sich das 2005 bei „Herder spektrum“ von Frank Schäfer („Metal Störies“) unter seinem Pseudonym Fritz Pfäfflin herausgegebene, ca. 190 Seiten starke Büchlein. Unterteilt in 16 Kapitel schreiben ebenso viele verschiedene Autoren ihre Erinnerungen auf, die sie mit bestimmten Songs quer durch unterschiedliche Genres verbinden. Das Spektrum reicht von der pubertären ersten Sommerliebe (sehr schön: Fritz Tietz – Alte Liebe) und schmerzhaften Verlusten im familiären Umfeld über das Entdecken bestimmter Musik, Partyerinnerungen, unerfüllte Erwartungen, juvenilen Sex, Reminiszenzen an eine Casting-Show und die damit verbundenen Dialoge zweier Freundinnen (ungewöhnlich, aber herausragend: Kerstin Grether – Candy und Mandy tun’s) bis hin zu Liebeserklärungen an lateinamerikanische Klänge und Hassbekundungen gegenüber Disco-Rhythmen. Frank Schäfer persönlich bedient die Abteilung des Härteren (THIN LZZY – Renegade), Ueli Bernays widmet sich in einer tragischen Geschichte der Homosexualität und Michael Quasthoff beschreibt aufs Köstlichste, jedoch nicht minder tragisch seine Konfrontation mit der Unterschicht und dem Punk der Band HANS-A-PLAST. Satiriker Oliver Maria Schmitt gibt ein fiktives Kapitel aus seinem (selbst-)ironischen Punk-Roman „Anarchoshnitzel schrieen sie“ zum Besten, bei dessen Genuss man noch einmal so richtig lachen kann. Inhaltliche Tragweite und Schreibstil schwanken selbstredend angesichts des Autoren-Potpourris, große Ereignisse reichen biographischen Randnotizen die Hand, bisweilen wird es gar inhaltlich nichtssagend, dafür jedoch stilistisch interessant. Als Strandlektüre im Warnemünder Kurzurlaub jedenfalls habe ich „Soundtrack eines Sommers“ genossen und ich bin geneigt, eine Playlist aller genannten Songs zusammenzustellen – wenngleich diese sicherlich nicht Soundtrack meines Sommers werden würde. Welcher das sein wird, wird sich erst noch zeigen – ich bin jedenfalls ganz Ohr.
Menschen, die über ein Mindestmaß an Empfindsamkeit verfügen, neigen dazu, prägende Lebensabschnitte oder -ereignisse mit Songs in Verbindung zu bringen. Diese müssen inhaltlich gar nicht einmal zwingend dazu passen, sondern einfach zu jener Zeit präsent gewesen zu sein – ob bewusst oder unbewusst ausgewählt oder ohne eigenes Zutun dank medialer Omnipräsenz. Ertönt Jahre später solch ein Lied, ist sofort die Erinnerung oder ein bestimmtes Gefühl wie aus dem Nichts wieder wach. Es wird schwierig, einen solchen Song wieder anders im Unterbewusstsein zu verknüpfen, aber i.d.R. will man das auch gar nicht, schwelgt stattdessen in süßer oder bitterer Melancholie. Einer Reihe Beispiele für dieses Phänomen widmet sich das 2005 bei „Herder spektrum“ von Frank Schäfer („Metal Störies“) unter seinem Pseudonym Fritz Pfäfflin herausgegebene, ca. 190 Seiten starke Büchlein. Unterteilt in 16 Kapitel schreiben ebenso viele verschiedene Autoren ihre Erinnerungen auf, die sie mit bestimmten Songs quer durch unterschiedliche Genres verbinden. Das Spektrum reicht von der pubertären ersten Sommerliebe (sehr schön: Fritz Tietz – Alte Liebe) und schmerzhaften Verlusten im familiären Umfeld über das Entdecken bestimmter Musik, Partyerinnerungen, unerfüllte Erwartungen, juvenilen Sex, Reminiszenzen an eine Casting-Show und die damit verbundenen Dialoge zweier Freundinnen (ungewöhnlich, aber herausragend: Kerstin Grether – Candy und Mandy tun’s) bis hin zu Liebeserklärungen an lateinamerikanische Klänge und Hassbekundungen gegenüber Disco-Rhythmen. Frank Schäfer persönlich bedient die Abteilung des Härteren (THIN LZZY – Renegade), Ueli Bernays widmet sich in einer tragischen Geschichte der Homosexualität und Michael Quasthoff beschreibt aufs Köstlichste, jedoch nicht minder tragisch seine Konfrontation mit der Unterschicht und dem Punk der Band HANS-A-PLAST. Satiriker Oliver Maria Schmitt gibt ein fiktives Kapitel aus seinem (selbst-)ironischen Punk-Roman „Anarchoshnitzel schrieen sie“ zum Besten, bei dessen Genuss man noch einmal so richtig lachen kann. Inhaltliche Tragweite und Schreibstil schwanken selbstredend angesichts des Autoren-Potpourris, große Ereignisse reichen biographischen Randnotizen die Hand, bisweilen wird es gar inhaltlich nichtssagend, dafür jedoch stilistisch interessant. Als Strandlektüre im Warnemünder Kurzurlaub jedenfalls habe ich „Soundtrack eines Sommers“ genossen und ich bin geneigt, eine Playlist aller genannten Songs zusammenzustellen – wenngleich diese sicherlich nicht Soundtrack meines Sommers werden würde. Welcher das sein wird, wird sich erst noch zeigen – ich bin jedenfalls ganz Ohr.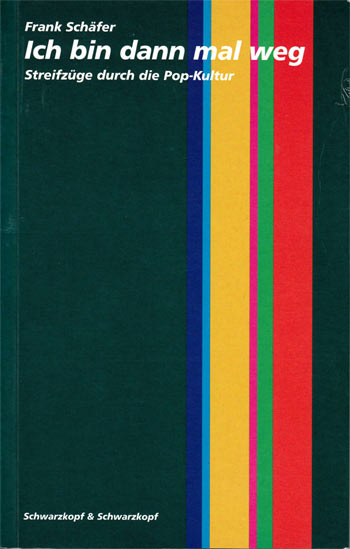 Frank Schäfer bzw. Dr. phil. Frank Schäfer veröffentlichte 2002 bei Schwarzkopf & Schwarzkopf eine rund 250 Seiten umfassende Sammlung in Postillen wie „Rolling Stone“, „taz“, „Titanic“, „Junge Welt“ etc. bereits veröffentlichter Erzählungen, Anekdoten, Beobachtungen, Erinnerungen etc., die für sich genommen jeweils lediglich wenige Seiten lang sind und zum Großteil noch einmal überarbeitet oder erstmals vollständig abgedruckt wurden. Als grober Aufhänger und Unterteilung dienen die Jahrzehnte der 1970er, -80er und -90er, deren mehr oder weniger populärkulturellen Phänomenen sich Schäfer ohne jedes Diktat der Vollständigkeit, allgemeiner Anerkennung oder Relevanz widmet. Dies geschieht mal in Form persönlich Reminiszenzen, mal in Polemiken, mal in fiktiven Dialogen etc., was neben der breitgefächerten Themenauswahl für willkommene Abwechslung sorgt. Schäfer beackert hauptsächlich die Felder Musik, Film und Literatur, womit er sich von jemandem wie mir, der mit all diesen Bereichen etwas anfangen kann, schon mal die Aufmerksamkeit sichert. Und so entpuppt sich auch diese Essay-Sammlung als kleine Wundertüte von Inhalten, die mein Interesse treffen oder zumindest ankratzen, aber auch gern einmal haarscharf daran vorbeischlittern oder mir lediglich Fragezeichen in die Mimik zaubern. Doch das bedingt nun einmal eine solch schwer subjektive Themenauswahl, die dennoch oder gerade deshalb geeignet ist, den eigenen Horizont zu erweitern oder zumindest von diesem oder jenem schon einmal etwas gehört gehabt zu haben. Der recht persönlich gehaltene Schreibstil kommt nicht immer ohne Schwurbeleien und Fremdwortkaskaden aus, verfügt aber oft genug über genügend Charme und Profil, um nicht zu nerven. Positiv auf das Lesevergnügen wirkt sich der vermittelte Eindruck aus, Schäfer habe lediglich Phänomene angeschnitten, zu denen er tatsächlich einen persönlichen Bezug hat oder hatte. Dass ich beispielsweise die 1990er ganz anders erlebt habe und vollkommen divergierende Erinnerungen und Künstler abgehandelt hätte, liegt da in der Natur der Sache. Dennoch sei einmal dahingestellt, wie viel die eine oder andere biographische Anekdote noch mit Pop-Kultur gemein hat – ohne sie damit abwerten zu wollen. Die Punk-Subkultur mit nur drei Seiten abzukanzeln oder in der „A Clockwork Orange“-Retrospektive erst gar nicht auf die spezielle Ästhetik Kubricks fulminanter Verfilmung und ihrer Signalwirkung auf die Subkultur einzugehen, empfinde ich aber als vertane Chance. Zu anderen Aufsätzen hingegen kann ich nur gratulieren, von „gut zusammengefasst und auf den Punkt gebracht“ über ob des Humors viel Schmunzeln bis hin zu gewecktem Interesse reichten meine unmittelbaren Reaktionen während der Lektüre, die in ihrer unprätentiösen Art und dem Blick für unspektakuläre, deshalb aber nicht gleich redundante Details sich einmal mehr schnell durchlesen lässt und dabei mit der mittlerweile gewohnten Schäfer’schen Mischung aus akademischem Habi- und Duktus, kumpelhaft-proletarischer Bodenständigkeit und ehrlicher Faszination für Pop- bis Subkultur trotz einiger Ausschweifungen in mir fremde und laut meines Bauchgefühls überbewertete Sphären gut und ansprechend unterhält. Denn bei allem, was Schäfer schreibt, schwingt irgendwie der Eindruck mit, dass man mit ihm gut und gerne in einer Arbeiterkneipe ein bis neun Bierchen pitschen und sich dabei leidenschaftlich über all diese liebgewonnenen Nebensächlichkeiten und ihre gesellschaftlichen oder auch persönlichen Auswirkungen abseits von Hochkultur und Weltpolitik unterhalten, freuen und streiten könnte…
Frank Schäfer bzw. Dr. phil. Frank Schäfer veröffentlichte 2002 bei Schwarzkopf & Schwarzkopf eine rund 250 Seiten umfassende Sammlung in Postillen wie „Rolling Stone“, „taz“, „Titanic“, „Junge Welt“ etc. bereits veröffentlichter Erzählungen, Anekdoten, Beobachtungen, Erinnerungen etc., die für sich genommen jeweils lediglich wenige Seiten lang sind und zum Großteil noch einmal überarbeitet oder erstmals vollständig abgedruckt wurden. Als grober Aufhänger und Unterteilung dienen die Jahrzehnte der 1970er, -80er und -90er, deren mehr oder weniger populärkulturellen Phänomenen sich Schäfer ohne jedes Diktat der Vollständigkeit, allgemeiner Anerkennung oder Relevanz widmet. Dies geschieht mal in Form persönlich Reminiszenzen, mal in Polemiken, mal in fiktiven Dialogen etc., was neben der breitgefächerten Themenauswahl für willkommene Abwechslung sorgt. Schäfer beackert hauptsächlich die Felder Musik, Film und Literatur, womit er sich von jemandem wie mir, der mit all diesen Bereichen etwas anfangen kann, schon mal die Aufmerksamkeit sichert. Und so entpuppt sich auch diese Essay-Sammlung als kleine Wundertüte von Inhalten, die mein Interesse treffen oder zumindest ankratzen, aber auch gern einmal haarscharf daran vorbeischlittern oder mir lediglich Fragezeichen in die Mimik zaubern. Doch das bedingt nun einmal eine solch schwer subjektive Themenauswahl, die dennoch oder gerade deshalb geeignet ist, den eigenen Horizont zu erweitern oder zumindest von diesem oder jenem schon einmal etwas gehört gehabt zu haben. Der recht persönlich gehaltene Schreibstil kommt nicht immer ohne Schwurbeleien und Fremdwortkaskaden aus, verfügt aber oft genug über genügend Charme und Profil, um nicht zu nerven. Positiv auf das Lesevergnügen wirkt sich der vermittelte Eindruck aus, Schäfer habe lediglich Phänomene angeschnitten, zu denen er tatsächlich einen persönlichen Bezug hat oder hatte. Dass ich beispielsweise die 1990er ganz anders erlebt habe und vollkommen divergierende Erinnerungen und Künstler abgehandelt hätte, liegt da in der Natur der Sache. Dennoch sei einmal dahingestellt, wie viel die eine oder andere biographische Anekdote noch mit Pop-Kultur gemein hat – ohne sie damit abwerten zu wollen. Die Punk-Subkultur mit nur drei Seiten abzukanzeln oder in der „A Clockwork Orange“-Retrospektive erst gar nicht auf die spezielle Ästhetik Kubricks fulminanter Verfilmung und ihrer Signalwirkung auf die Subkultur einzugehen, empfinde ich aber als vertane Chance. Zu anderen Aufsätzen hingegen kann ich nur gratulieren, von „gut zusammengefasst und auf den Punkt gebracht“ über ob des Humors viel Schmunzeln bis hin zu gewecktem Interesse reichten meine unmittelbaren Reaktionen während der Lektüre, die in ihrer unprätentiösen Art und dem Blick für unspektakuläre, deshalb aber nicht gleich redundante Details sich einmal mehr schnell durchlesen lässt und dabei mit der mittlerweile gewohnten Schäfer’schen Mischung aus akademischem Habi- und Duktus, kumpelhaft-proletarischer Bodenständigkeit und ehrlicher Faszination für Pop- bis Subkultur trotz einiger Ausschweifungen in mir fremde und laut meines Bauchgefühls überbewertete Sphären gut und ansprechend unterhält. Denn bei allem, was Schäfer schreibt, schwingt irgendwie der Eindruck mit, dass man mit ihm gut und gerne in einer Arbeiterkneipe ein bis neun Bierchen pitschen und sich dabei leidenschaftlich über all diese liebgewonnenen Nebensächlichkeiten und ihre gesellschaftlichen oder auch persönlichen Auswirkungen abseits von Hochkultur und Weltpolitik unterhalten, freuen und streiten könnte…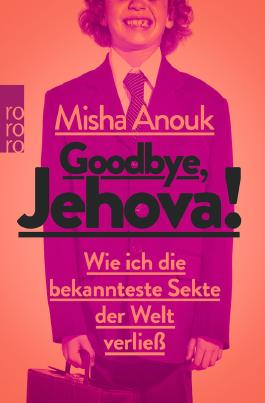 Der 1981 auf Gibraltar geborene Misha Anouk ist britischer Staatsbürger, in Bielefeld aufgewachsen, Autor und Poetry-Slammer – und war bis zu seinem zwanzigsten Lebensjahr Zeuge Jehovas. In seinem 2014 erschienenen autobiographischen und gut 500 Seiten starken Buch „Goodbye, Jehova! Wie ich die bekannteste Sekte der Welt verließ“ beschreibt er in wunderbar unaufgeregtem Stil seine Kindheit als Sohn strenger Zeugen Jehovas, sein Aufwachsen innerhalb der Sekte, die Irrungen und Wirrungen und die vielen Dilemmas, die das mit sich bringt – und schließlich seinen ebenso erfolgreichen wie folgenreichen Ausstieg. Dabei holt er den Leser dort ab, wo dieser die Zeugen Jehovas aller Wahrscheinlichkeit nach stehen sieht – als Missionare vor der Haustür. Sein Buch ist gespickt mit viel Humor und Selbstironie und alles andere als eine wütende Anklage. Geht es direkt um die Zeugen Jehovas und die hinter ihnen stehende Wachtturm-Gesellschaft (WTG), geht er stattdessen so sachlich wie möglich und voller Akribie zur Sache, zitiert zahlreiche Publikationen der WTG und verwendet hunderte Fußnoten, deckt die Mechanismen der Sekte auf. Doch obgleich er auch sagt, dass nicht alles schlecht war, räumt er mit kaum einem Vorurteil auf, denn auch in seiner Analyse bestätigt sich das allgemeine Bild der Zeugen Jehovas als die Bibel trotz all ihrer Widersprüche wörtlich zu nehmen versuchende Sekte, die sich auch manch „Wahrheit“ gern mal allzu bemüht zurechtbiegt und glaubt, die einzig wahre Interpretation der „heiligen Schrift“ für sich gepachtet zu haben, zentralistisch gesteuert wird und weder Zweifel noch Widerspruch von ihren Schäfchen duldet. Er geht davon aus, dass keine ausschließlich am schnöden Mammon interessierten Geldhaie die Sekte leiten, sondern Menschen, die ihre Lebenslügen tatsächlich glauben. Ja, auch bei Anouk sind die Zeugen Jehovas im Prinzip harmlose Spinner, die einer derart simplen und stumpfsinnigen Ideologie folgen, dass sie für normale, durchschnittlich vernunftbegabte Menschen keine Gefahr darstellen – zu durchschaubar ist ihr Handeln. Auf fruchtbaren Boden fällt ihr missionarischer Eifer jedoch mitunter bei schwachen Menschen oder Menschen in Krisensituationen, denen die Gemeinschaft der Sekte neuen Halt im Leben gibt, indem sie bereit sind, all die einfachen Lösungen zu akzeptieren und ihr Leben in ein von Demut geprägtes strenges Verhaltenskorsett zu zwängen. Wenn man denn so will, könnte man hier von freien Entscheidungen mündiger Menschen sprechen, wenngleich gezielt Ängste geschürt werden. Wie es sich jedoch bei Kindern verhält, die innerhalb der Sekte aufwachsen, beschreibt Anouk anhand seines eigenen Beispiels sehr detailliert, offen und persönlich. So wird deutlich, in welchem Ausmaße er indoktriniert und zu großen Teilen seiner Kindheit beraubt wurde. Dass er dabei seinen Humor nicht verloren hat und nie in Jammerei verfällt, ist ihm hoch anzurechnen. Bei allem seziert er säuberlich das Lügenkonstrukt der WTG um den bevorstehenden Weltuntergang, den „Harmagedon“, und den streng autoritären Umgang mit den Mitgliedern, was keinesfalls einer perfiden, trickreichen Psychologie gleichkommt, sondern derart simpel gestrickt ist und voller offensichtlicher Fehler steckt (beispielsweise milchmädchenhaft errechnete Weltuntergangstermine, die immer wieder korrigiert werden mussten), dass man sich wundert, wie erwachsene Menschen darauf hereinfallen können. Wenn Anouk aber ein paar Schritte aus der Sekte herausmacht und sich allgemein dem Thema Religion und ihrem Nutzen widmet, wird deutlich, dass es eben Menschen gibt, die mit dem Leben in Freiheit überfordert sind und die feste Struktur eines selbstgewählten geistigen Gefängnisses regelrecht suchen. Dies ist einer der großen Pluspunkte des Buchs: Es empfiehlt keinesfalls als Alternative die etablierten Kirchen, sondern rechnet mit (organisierter) Religion allgemein ab. Was all das jedoch für einen Menschen bedeutet, der seit Geburt an mit dieser Ideologie konfrontiert wird und als jugendlicher Ausstiegspläne zu hegen beginnt, kann sich wohl kaum jemand vorstellen, der das nicht selbst erlebt hat. Diese Komponente Anouks Buchs ist sowohl psychologisch als auch schlicht menschlich interessant und spannend, in schonungsloser Offenheit erzählt und wird zwischen den Kapiteln bereits immer mal wieder kurz angeteasert. Allerspätestens beim Ausstieg (der strenggenommen ein Ausschluss war) wird es dann auch richtig ernst und ohne falsche Scham verdeutlicht Anouk, wie schwer ihm ein Leben ohne die Gemeinschaft, vor allem aber ohne seine Eltern, die den Kontakt zu ihm daraufhin abbrachen, fiel und wie es sich anfühlte, von einem Tag auf den anderen in die Realität gestoßen zu werden: „Es gibt einen Grund, weshalb man sich nicht an die eigene Geburt erinnert. Ich wurde ein zweites Mal geboren und bekam diesmal das ganze Grauen in jedem kleinsten Detail mit, ich wurde hineingeworfen, unvorbereitet, in die echte Welt. Und ich hatte nicht die geringste Ahnung vom echten Leben, dort draußen in der Wildnis, vor der ich gegen meinen Willen behütet worden war. Das neue Leben packte mich bei beiden Füßen und schlug mich auf den Hintern, bis ich schrie, bis ich selbständig atmete.“ Geradezu beiläufig schockiert er mit einem Selbstmordversuch und gesteht, wie er dem Alkoholismus sowie massiven psychischen Problemen anheim fiel, bis er sich endlich zu fangen und ein tatsächlich selbstbestimmtes Leben zu führen imstande war. Eindrucksvoll zeigt dies die Folgen einer in entscheidenden Fragen, hier sektenbedingt versagt habenden Erziehung auf und lassen Anouks Schilderungen Rückschlüsse auf die Kämpfe zu, die generell Aussteiger aus extrem autoritären, selbstbestimmtes Denken und Handeln negativ konnotierenden Gemeinschaften zu bewältigen haben. Ich kann Mischa Anouk nur Respekt zollen und sowohl zu seinem derzeitigen Leben als auch diesem Buch mit all seiner weit über die Zeugen Jehovas hinausgehenden Christentum- und Religionskritik beglückwünschen und es allen ans Herz legen, die auf schwer sympathische Weise aus erster Hand mehr über eben all diese Themen erfahren möchten, ohne sich seitenlang durch Zorn, Trauer, Missmut und andere nur allzu menschliche Emotionen kämpfen zu müssen, die derartigen Werken den bitteren Beigeschmack persönlicher rachegesteuerter Abrechnungen verleihen und in ihrer Subjektivität sowohl Sachlichkeit als auch den eigentlichen Kern zu vergessen drohen. Ganz im Gegenteil dazu findet Anouk eine erfrischende Balance und überzeugt mit augenzwinkerndem Witz statt mit Rachsucht. Mein einziger Kritikpunkt wäre seine WTG-Zitatewut, evtl. wäre hier weniger mehr gewesen – denn sich immer wieder durch manipulative Absätze in stupidester Sekten-Westentaschen-Psychologie zu kämpfen, kostete mich dann und wann dann doch etwas Überwindung bei der Lektüre. Andererseits sind dies natürlich exzellente abschreckende Beispiele und somit vermutlich doch ganz gut dort aufgehoben.
Der 1981 auf Gibraltar geborene Misha Anouk ist britischer Staatsbürger, in Bielefeld aufgewachsen, Autor und Poetry-Slammer – und war bis zu seinem zwanzigsten Lebensjahr Zeuge Jehovas. In seinem 2014 erschienenen autobiographischen und gut 500 Seiten starken Buch „Goodbye, Jehova! Wie ich die bekannteste Sekte der Welt verließ“ beschreibt er in wunderbar unaufgeregtem Stil seine Kindheit als Sohn strenger Zeugen Jehovas, sein Aufwachsen innerhalb der Sekte, die Irrungen und Wirrungen und die vielen Dilemmas, die das mit sich bringt – und schließlich seinen ebenso erfolgreichen wie folgenreichen Ausstieg. Dabei holt er den Leser dort ab, wo dieser die Zeugen Jehovas aller Wahrscheinlichkeit nach stehen sieht – als Missionare vor der Haustür. Sein Buch ist gespickt mit viel Humor und Selbstironie und alles andere als eine wütende Anklage. Geht es direkt um die Zeugen Jehovas und die hinter ihnen stehende Wachtturm-Gesellschaft (WTG), geht er stattdessen so sachlich wie möglich und voller Akribie zur Sache, zitiert zahlreiche Publikationen der WTG und verwendet hunderte Fußnoten, deckt die Mechanismen der Sekte auf. Doch obgleich er auch sagt, dass nicht alles schlecht war, räumt er mit kaum einem Vorurteil auf, denn auch in seiner Analyse bestätigt sich das allgemeine Bild der Zeugen Jehovas als die Bibel trotz all ihrer Widersprüche wörtlich zu nehmen versuchende Sekte, die sich auch manch „Wahrheit“ gern mal allzu bemüht zurechtbiegt und glaubt, die einzig wahre Interpretation der „heiligen Schrift“ für sich gepachtet zu haben, zentralistisch gesteuert wird und weder Zweifel noch Widerspruch von ihren Schäfchen duldet. Er geht davon aus, dass keine ausschließlich am schnöden Mammon interessierten Geldhaie die Sekte leiten, sondern Menschen, die ihre Lebenslügen tatsächlich glauben. Ja, auch bei Anouk sind die Zeugen Jehovas im Prinzip harmlose Spinner, die einer derart simplen und stumpfsinnigen Ideologie folgen, dass sie für normale, durchschnittlich vernunftbegabte Menschen keine Gefahr darstellen – zu durchschaubar ist ihr Handeln. Auf fruchtbaren Boden fällt ihr missionarischer Eifer jedoch mitunter bei schwachen Menschen oder Menschen in Krisensituationen, denen die Gemeinschaft der Sekte neuen Halt im Leben gibt, indem sie bereit sind, all die einfachen Lösungen zu akzeptieren und ihr Leben in ein von Demut geprägtes strenges Verhaltenskorsett zu zwängen. Wenn man denn so will, könnte man hier von freien Entscheidungen mündiger Menschen sprechen, wenngleich gezielt Ängste geschürt werden. Wie es sich jedoch bei Kindern verhält, die innerhalb der Sekte aufwachsen, beschreibt Anouk anhand seines eigenen Beispiels sehr detailliert, offen und persönlich. So wird deutlich, in welchem Ausmaße er indoktriniert und zu großen Teilen seiner Kindheit beraubt wurde. Dass er dabei seinen Humor nicht verloren hat und nie in Jammerei verfällt, ist ihm hoch anzurechnen. Bei allem seziert er säuberlich das Lügenkonstrukt der WTG um den bevorstehenden Weltuntergang, den „Harmagedon“, und den streng autoritären Umgang mit den Mitgliedern, was keinesfalls einer perfiden, trickreichen Psychologie gleichkommt, sondern derart simpel gestrickt ist und voller offensichtlicher Fehler steckt (beispielsweise milchmädchenhaft errechnete Weltuntergangstermine, die immer wieder korrigiert werden mussten), dass man sich wundert, wie erwachsene Menschen darauf hereinfallen können. Wenn Anouk aber ein paar Schritte aus der Sekte herausmacht und sich allgemein dem Thema Religion und ihrem Nutzen widmet, wird deutlich, dass es eben Menschen gibt, die mit dem Leben in Freiheit überfordert sind und die feste Struktur eines selbstgewählten geistigen Gefängnisses regelrecht suchen. Dies ist einer der großen Pluspunkte des Buchs: Es empfiehlt keinesfalls als Alternative die etablierten Kirchen, sondern rechnet mit (organisierter) Religion allgemein ab. Was all das jedoch für einen Menschen bedeutet, der seit Geburt an mit dieser Ideologie konfrontiert wird und als jugendlicher Ausstiegspläne zu hegen beginnt, kann sich wohl kaum jemand vorstellen, der das nicht selbst erlebt hat. Diese Komponente Anouks Buchs ist sowohl psychologisch als auch schlicht menschlich interessant und spannend, in schonungsloser Offenheit erzählt und wird zwischen den Kapiteln bereits immer mal wieder kurz angeteasert. Allerspätestens beim Ausstieg (der strenggenommen ein Ausschluss war) wird es dann auch richtig ernst und ohne falsche Scham verdeutlicht Anouk, wie schwer ihm ein Leben ohne die Gemeinschaft, vor allem aber ohne seine Eltern, die den Kontakt zu ihm daraufhin abbrachen, fiel und wie es sich anfühlte, von einem Tag auf den anderen in die Realität gestoßen zu werden: „Es gibt einen Grund, weshalb man sich nicht an die eigene Geburt erinnert. Ich wurde ein zweites Mal geboren und bekam diesmal das ganze Grauen in jedem kleinsten Detail mit, ich wurde hineingeworfen, unvorbereitet, in die echte Welt. Und ich hatte nicht die geringste Ahnung vom echten Leben, dort draußen in der Wildnis, vor der ich gegen meinen Willen behütet worden war. Das neue Leben packte mich bei beiden Füßen und schlug mich auf den Hintern, bis ich schrie, bis ich selbständig atmete.“ Geradezu beiläufig schockiert er mit einem Selbstmordversuch und gesteht, wie er dem Alkoholismus sowie massiven psychischen Problemen anheim fiel, bis er sich endlich zu fangen und ein tatsächlich selbstbestimmtes Leben zu führen imstande war. Eindrucksvoll zeigt dies die Folgen einer in entscheidenden Fragen, hier sektenbedingt versagt habenden Erziehung auf und lassen Anouks Schilderungen Rückschlüsse auf die Kämpfe zu, die generell Aussteiger aus extrem autoritären, selbstbestimmtes Denken und Handeln negativ konnotierenden Gemeinschaften zu bewältigen haben. Ich kann Mischa Anouk nur Respekt zollen und sowohl zu seinem derzeitigen Leben als auch diesem Buch mit all seiner weit über die Zeugen Jehovas hinausgehenden Christentum- und Religionskritik beglückwünschen und es allen ans Herz legen, die auf schwer sympathische Weise aus erster Hand mehr über eben all diese Themen erfahren möchten, ohne sich seitenlang durch Zorn, Trauer, Missmut und andere nur allzu menschliche Emotionen kämpfen zu müssen, die derartigen Werken den bitteren Beigeschmack persönlicher rachegesteuerter Abrechnungen verleihen und in ihrer Subjektivität sowohl Sachlichkeit als auch den eigentlichen Kern zu vergessen drohen. Ganz im Gegenteil dazu findet Anouk eine erfrischende Balance und überzeugt mit augenzwinkerndem Witz statt mit Rachsucht. Mein einziger Kritikpunkt wäre seine WTG-Zitatewut, evtl. wäre hier weniger mehr gewesen – denn sich immer wieder durch manipulative Absätze in stupidester Sekten-Westentaschen-Psychologie zu kämpfen, kostete mich dann und wann dann doch etwas Überwindung bei der Lektüre. Andererseits sind dies natürlich exzellente abschreckende Beispiele und somit vermutlich doch ganz gut dort aufgehoben. Das 2004 im Maro-Verlag erschienene, knapp 200 Seite starke Büchlein sammelt Autor und Musikjournalist Frank Schäfers Anekdoten um Lebenskünstler und Geschichtenerzähler Thomas Püschel, die zuvor jeweils in der Samstagsbeilage der „jungen Welt“ veröffentlicht wurden, in ungekürzter und überarbeiteter Form. Die meist nur wenige Seiten kurzen Storys handeln von eben jenem Pünschel, einem Kumpel des Erzählers und verhindertem Erfolgsautor, der sich irgendwie durchs Leben schlägt, immer wieder bizarre Situationen erlebt, diese aber auch selbst gern erzählerisch ausschmückt oder gar gänzlich frei erfindet bzw. etwas bedeutungsschwanger wiedergibt, was er irgendwo aufgeschnappt hat – einfach um etwas zu erzählen zu haben. Damit er liegt er regelmäßig dem Erzähler in den Ohren, wenn sie sich i.d.R. irgendwo in Braunschweig treffen, an der Supermarktkasse oder in der Kneipe. Die Charakterisierung Pünschels wechselt dabei durchaus bzw. geschieht ambivalent: Vom Laberkopp, mit dem man besser nur die nötigsten Worte wechselt über den kleinkriminellen Unsympathen bis hin zum liebenswerten Musik-, Film- und Literaturliebhaber und eben Lebenskünstler. Die pointierten Geschichten sind manchmal ziemlich unspektakulär, aber auch haarsträubend, witzig, absurd, augenzwinkernd, sympathisch. Immer mal wieder scheint auch Schäfers Kunst- und Popkultur-Verständnis durch, so dass manch Story wunderbar nerdig ausfällt. Mein persönlicher Höhepunkt ist die Persiflage auf den Nadsat-Jargon aus Anthony Burgess’ Roman „A Clockwork Orange“. Vieles mutet recht autobiographisch an und so tauchen z.B. auch bekannte Namen aus Schäfers Rockroman „Die Welt ist eine Scheibe“ auf; eine andere Geschichte mit Musikbezug wiederum war bekannt aus Schäfers Sachbuch „Heavy Metal“. Die Kürze der Geschichten lädt dazu ein, jeweils schnell noch eine zu lesen, und noch eine, bis man sie schließlich alsbald alle durch hat. Den einen oder anderen Rohrkrepierer verzeiht man da gern, dann zündet eben die nächste. Unterhaltsame, kurzweilige und wie so oft bei Schäfer charmante und irgendwie einnehmende Konfrontation der betonten Bodenständigkeit des Erzählers (und eben vermutlich Schäfer-Alter-Egos) mit der skurrilen Weltsicht und Phantasie seines Gegenübers, die er sich selbst tendenziell verbietet, der er auf diese Weise aber freien Lauf lassen kann.
Das 2004 im Maro-Verlag erschienene, knapp 200 Seite starke Büchlein sammelt Autor und Musikjournalist Frank Schäfers Anekdoten um Lebenskünstler und Geschichtenerzähler Thomas Püschel, die zuvor jeweils in der Samstagsbeilage der „jungen Welt“ veröffentlicht wurden, in ungekürzter und überarbeiteter Form. Die meist nur wenige Seiten kurzen Storys handeln von eben jenem Pünschel, einem Kumpel des Erzählers und verhindertem Erfolgsautor, der sich irgendwie durchs Leben schlägt, immer wieder bizarre Situationen erlebt, diese aber auch selbst gern erzählerisch ausschmückt oder gar gänzlich frei erfindet bzw. etwas bedeutungsschwanger wiedergibt, was er irgendwo aufgeschnappt hat – einfach um etwas zu erzählen zu haben. Damit er liegt er regelmäßig dem Erzähler in den Ohren, wenn sie sich i.d.R. irgendwo in Braunschweig treffen, an der Supermarktkasse oder in der Kneipe. Die Charakterisierung Pünschels wechselt dabei durchaus bzw. geschieht ambivalent: Vom Laberkopp, mit dem man besser nur die nötigsten Worte wechselt über den kleinkriminellen Unsympathen bis hin zum liebenswerten Musik-, Film- und Literaturliebhaber und eben Lebenskünstler. Die pointierten Geschichten sind manchmal ziemlich unspektakulär, aber auch haarsträubend, witzig, absurd, augenzwinkernd, sympathisch. Immer mal wieder scheint auch Schäfers Kunst- und Popkultur-Verständnis durch, so dass manch Story wunderbar nerdig ausfällt. Mein persönlicher Höhepunkt ist die Persiflage auf den Nadsat-Jargon aus Anthony Burgess’ Roman „A Clockwork Orange“. Vieles mutet recht autobiographisch an und so tauchen z.B. auch bekannte Namen aus Schäfers Rockroman „Die Welt ist eine Scheibe“ auf; eine andere Geschichte mit Musikbezug wiederum war bekannt aus Schäfers Sachbuch „Heavy Metal“. Die Kürze der Geschichten lädt dazu ein, jeweils schnell noch eine zu lesen, und noch eine, bis man sie schließlich alsbald alle durch hat. Den einen oder anderen Rohrkrepierer verzeiht man da gern, dann zündet eben die nächste. Unterhaltsame, kurzweilige und wie so oft bei Schäfer charmante und irgendwie einnehmende Konfrontation der betonten Bodenständigkeit des Erzählers (und eben vermutlich Schäfer-Alter-Egos) mit der skurrilen Weltsicht und Phantasie seines Gegenübers, die er sich selbst tendenziell verbietet, der er auf diese Weise aber freien Lauf lassen kann.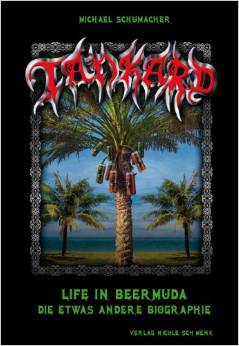 Autor Michael Schumacher ist natürlich nicht zu verwechseln mit dem Formel-1-Weltmeister. Der Namensvetter des Rennfahrers ist Musikwissenschaftler und Doktorand an der Kölner Uni, aber was viel wichtiger ist: Fan der hessischen Thrash-Band TANKARD. So fühlte er sich berufen, einmal deren Biographie aufzuschreiben, was zu diesem 200 Seiten starken Schmöker geführt hat, der im schicken, festen Einband kommt und die Geschichte der Frankfurter rekapituliert. Die Schrift ist relativ groß, das Buch reich bebildert, mit zahlreichen eingestreuten Kommentaren von Musiker-Kollegen gespickt und um einen Anhang ergänzt, der eine komplette Konzertübersicht liefert. Verglichen mit anderen Biographien von Bands, die ähnlich lange existieren, bleibt also gar nicht allzu viel Platz, um wirklich in die Tiefe zu gehen. Dennoch klappert Schumacher die wichtigsten Stationen der Bandkarriere ab, hat viele witzige Anekdoten auf Lager (von denen natürlich viele mit Alkoholkonsum und Zerstörungswut zu tun haben) und schafft es, zu vermitteln, was es bedeutet, eine Band wie TANKARD als Hobby, aber dennoch professionell zu betreiben: Dies bedeutet nämlich keinesfalls, versagt oder „es nicht geschafft“ zu haben, sondern im Falle TANKARDs bodenständig zu bleiben, weitestgehend unabhängig zu sein und sich seine künstlerische Freiheit kompromisslos zu bewahren – sowie konstant abzuliefern, auch durch Täler hindurch, in der Thrash Metal gerade wenig populär ist. Das liest sich ebenso kurzweilig wie interessant, wobei natürlich die Anfangstage am spannendsten sind, aber auch die Zeit des Mauerfalls verdient besondere Aufmerksamkeit. Jede Plattenproduktion (derer es bei TANKARD viele gibt) wird zumindest einmal angeschnitten und die ersten vier Alben gehören meines Erachtens zur Pflichtausstattung einer Thrash-Sammlung. Was danach kam, empfand ich häufig als etwas durchwachsen und was das Buch leider nicht wirklich geschafft hat, ist es, mir jene Platten noch einmal schmackhaft zu machen, mich häufiger auf bestimmte Songs, evtl. vergessene oder übersehene Perlen hinzuweisen o.ä. Gerade auch in Bezug auf die Texte der Band, die zwar i.d.R. über viel Humor und Selbstironie verfügen, aber auch sehr kritische und ernste Töne anschlagen können, hätte ich mir mehr gewünscht, denn ich glaube, dass Shouter Gerre & Co. viel Leidenschaft und Herzblut in manch Song fließen lassen. Relevanter (und mitunter sehr aufschlussreich) sind da aber verständlicherweise die Interviews mit Ex-TANKARD-Musikern, Manager Buffo, Produzenten, Label-Betreibern und Cover-Künstler Sascha Krüger sowie die Abschnitte über das NDW- und Schlager-Cover-Nebenprojekt TANKWART (etwas arg unkritisch) und das Engagement für Eintracht Frankfurt. Alles in allem ein sympathisches Buch über eine ebensolche Band, die vor allem live ein absoluter Killer ist, sich selbst stets treu geblieben ist, noch immer aufopferungsvoll dem ehrlichen Thrash frönt und anscheinend nie weniger als 100% gibt. Den Charme der trinkfesten Hessen fängt „A Life in Beermuda“ gut ein und liefert einen gelungenen Einblick in ihr Selbstverständnis. Die „etwas andere Biographie“ dokumentiert ein wichtiges Stück deutsche Thrash-Geschichte und ist deshalb sowohl für TANKARD-Fans als auch -Kritiker und -Skeptiker von Interesse – Hauptsache Musikliebhaber. Überfordern sollte es niemanden, denn es liest sich innerhalb einiger Stunden schnell weg. Darauf ein Space Beer!
Autor Michael Schumacher ist natürlich nicht zu verwechseln mit dem Formel-1-Weltmeister. Der Namensvetter des Rennfahrers ist Musikwissenschaftler und Doktorand an der Kölner Uni, aber was viel wichtiger ist: Fan der hessischen Thrash-Band TANKARD. So fühlte er sich berufen, einmal deren Biographie aufzuschreiben, was zu diesem 200 Seiten starken Schmöker geführt hat, der im schicken, festen Einband kommt und die Geschichte der Frankfurter rekapituliert. Die Schrift ist relativ groß, das Buch reich bebildert, mit zahlreichen eingestreuten Kommentaren von Musiker-Kollegen gespickt und um einen Anhang ergänzt, der eine komplette Konzertübersicht liefert. Verglichen mit anderen Biographien von Bands, die ähnlich lange existieren, bleibt also gar nicht allzu viel Platz, um wirklich in die Tiefe zu gehen. Dennoch klappert Schumacher die wichtigsten Stationen der Bandkarriere ab, hat viele witzige Anekdoten auf Lager (von denen natürlich viele mit Alkoholkonsum und Zerstörungswut zu tun haben) und schafft es, zu vermitteln, was es bedeutet, eine Band wie TANKARD als Hobby, aber dennoch professionell zu betreiben: Dies bedeutet nämlich keinesfalls, versagt oder „es nicht geschafft“ zu haben, sondern im Falle TANKARDs bodenständig zu bleiben, weitestgehend unabhängig zu sein und sich seine künstlerische Freiheit kompromisslos zu bewahren – sowie konstant abzuliefern, auch durch Täler hindurch, in der Thrash Metal gerade wenig populär ist. Das liest sich ebenso kurzweilig wie interessant, wobei natürlich die Anfangstage am spannendsten sind, aber auch die Zeit des Mauerfalls verdient besondere Aufmerksamkeit. Jede Plattenproduktion (derer es bei TANKARD viele gibt) wird zumindest einmal angeschnitten und die ersten vier Alben gehören meines Erachtens zur Pflichtausstattung einer Thrash-Sammlung. Was danach kam, empfand ich häufig als etwas durchwachsen und was das Buch leider nicht wirklich geschafft hat, ist es, mir jene Platten noch einmal schmackhaft zu machen, mich häufiger auf bestimmte Songs, evtl. vergessene oder übersehene Perlen hinzuweisen o.ä. Gerade auch in Bezug auf die Texte der Band, die zwar i.d.R. über viel Humor und Selbstironie verfügen, aber auch sehr kritische und ernste Töne anschlagen können, hätte ich mir mehr gewünscht, denn ich glaube, dass Shouter Gerre & Co. viel Leidenschaft und Herzblut in manch Song fließen lassen. Relevanter (und mitunter sehr aufschlussreich) sind da aber verständlicherweise die Interviews mit Ex-TANKARD-Musikern, Manager Buffo, Produzenten, Label-Betreibern und Cover-Künstler Sascha Krüger sowie die Abschnitte über das NDW- und Schlager-Cover-Nebenprojekt TANKWART (etwas arg unkritisch) und das Engagement für Eintracht Frankfurt. Alles in allem ein sympathisches Buch über eine ebensolche Band, die vor allem live ein absoluter Killer ist, sich selbst stets treu geblieben ist, noch immer aufopferungsvoll dem ehrlichen Thrash frönt und anscheinend nie weniger als 100% gibt. Den Charme der trinkfesten Hessen fängt „A Life in Beermuda“ gut ein und liefert einen gelungenen Einblick in ihr Selbstverständnis. Die „etwas andere Biographie“ dokumentiert ein wichtiges Stück deutsche Thrash-Geschichte und ist deshalb sowohl für TANKARD-Fans als auch -Kritiker und -Skeptiker von Interesse – Hauptsache Musikliebhaber. Überfordern sollte es niemanden, denn es liest sich innerhalb einiger Stunden schnell weg. Darauf ein Space Beer!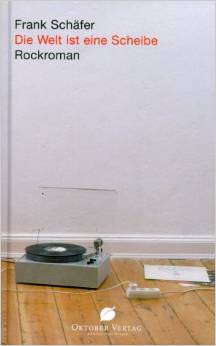 Nach seinem durchwachsenen, dennoch lesenswerten Sachbuch zum Thema Heavy Metal debütierte der Journalist und Autor Frank Schäfer 2001 im Bereich der Erzählungen mit diesem „Rockroman“, für den er weitestgehend auf eine verschwurbelte Schreibweise verzichtete und stattdessen auf rund 180 Seiten aller Wahrscheinlichkeit nach stark autobiographisch geprägt das Lebensgefühl als Nachwuchs-Metal-Musiker der Band „Adrenalin“ in der niedersächsischen Provinz der ‘80er-Jahre nachzeichnet. Es ist die Zeit der ersten Konzerte und professionellen Studioaufnahmen sowie pubertärer Liebeleien und Wirrungen, der großen Liebe, der Aufbruchsstimmung, aber auch der Rückschläge und Enttäuschungen. Angesichts der knappen Seitenzahl gelingt es Schäfer überraschend detailliert, die Leidenschaft der Jungmusiker zu vermitteln, plaudert aus dem Nähkästchen einer noch am Anfang stehenden Band und porträtiert mit scharfem Blick das persönliche Umfeld zwischen Bandkollegen und Familienangehörigen sowie die Begegnungen mit Konzertveranstaltern, Studiobetreibern etc. Dabei ist natürlich nicht alles eitel Sonnenschein, schwere Schicksalsschläge gilt es ebenso zu verdauen wie mit schwierigen Dreiecksbeziehungen umzugehen. Für den Erzähler ist jene Zeit eine ganz besonders spannende, denn er kommt mit seiner Freundin Moni zusammen und startet mit seiner Band durch. Dokumentiert wird dies neben Schäfers Ausführungen in Form evtl. gar authentischer Schriftstücke von Labels inkl. echter Namen, Songtext-Auszügen und ganz konkreten Veranschaulichungen von Songstrukturen, Studioeinspielungen und Konzertberichten, wie sie nur aus der Feder eines Schreibers stammen können, der genau das selbst erlebt hat (Schäfer war Gitarrist der Power-Metal-Band „Salem’s Law“ und „Adrenalin“ deren Vorgängerband). Somit handelt es sich nicht nur um ein Stück wenig verklärende Nostalgie für alte Säcke, sondern um einen gerade auch für Außenstehende und Zuspätgeborene spannenden Einblick in eine Zeit, die sich in vielerlei Hinsicht von der heutigen unterschied, jedoch in nicht wenigen Aspekten auch der Gegenwart ähnelt, wenn man voller Motivation eine Band gründet und seine ersten Schritte tut oder einer verführerischen jungen Dame verfällt – denn manches ändert sich nie. Wer sich grundsätzlich für die angesprochenen Themen interessiert, findet in „Die Welt ist eine Scheibe“ ein fesselnd und ebenso gefühl- wie humorvoll geschriebenes Büchlein, das sich sehr flüssig und schnell liest, richtig Lust macht auf die Musik der Band „Adrenalin“ oder eben ähnlich geartete und neben zu vernachlässigenden Details im Prinzip nur einen Fehler hat: Es ist zu kurz und das offene Ende hinterlässt einen angerührten Leser, der nur zu gerne wissen will, wie es weiterging. Ein gelungenes und sympathisches Debüt, das beweist, dass auch solch kleine Bandgeschichten ohne große Exzesse und klischeebewehrte Ausschlachtungen über viel Charme verfügen und in ihrer Ehrlichkeit, Offenheit und unprätentiösen Bodenständigkeit bestechender sein können als der abgedrehte Nerd-Roman oder die drogen- und sexschwangere Rockbiographie.
Nach seinem durchwachsenen, dennoch lesenswerten Sachbuch zum Thema Heavy Metal debütierte der Journalist und Autor Frank Schäfer 2001 im Bereich der Erzählungen mit diesem „Rockroman“, für den er weitestgehend auf eine verschwurbelte Schreibweise verzichtete und stattdessen auf rund 180 Seiten aller Wahrscheinlichkeit nach stark autobiographisch geprägt das Lebensgefühl als Nachwuchs-Metal-Musiker der Band „Adrenalin“ in der niedersächsischen Provinz der ‘80er-Jahre nachzeichnet. Es ist die Zeit der ersten Konzerte und professionellen Studioaufnahmen sowie pubertärer Liebeleien und Wirrungen, der großen Liebe, der Aufbruchsstimmung, aber auch der Rückschläge und Enttäuschungen. Angesichts der knappen Seitenzahl gelingt es Schäfer überraschend detailliert, die Leidenschaft der Jungmusiker zu vermitteln, plaudert aus dem Nähkästchen einer noch am Anfang stehenden Band und porträtiert mit scharfem Blick das persönliche Umfeld zwischen Bandkollegen und Familienangehörigen sowie die Begegnungen mit Konzertveranstaltern, Studiobetreibern etc. Dabei ist natürlich nicht alles eitel Sonnenschein, schwere Schicksalsschläge gilt es ebenso zu verdauen wie mit schwierigen Dreiecksbeziehungen umzugehen. Für den Erzähler ist jene Zeit eine ganz besonders spannende, denn er kommt mit seiner Freundin Moni zusammen und startet mit seiner Band durch. Dokumentiert wird dies neben Schäfers Ausführungen in Form evtl. gar authentischer Schriftstücke von Labels inkl. echter Namen, Songtext-Auszügen und ganz konkreten Veranschaulichungen von Songstrukturen, Studioeinspielungen und Konzertberichten, wie sie nur aus der Feder eines Schreibers stammen können, der genau das selbst erlebt hat (Schäfer war Gitarrist der Power-Metal-Band „Salem’s Law“ und „Adrenalin“ deren Vorgängerband). Somit handelt es sich nicht nur um ein Stück wenig verklärende Nostalgie für alte Säcke, sondern um einen gerade auch für Außenstehende und Zuspätgeborene spannenden Einblick in eine Zeit, die sich in vielerlei Hinsicht von der heutigen unterschied, jedoch in nicht wenigen Aspekten auch der Gegenwart ähnelt, wenn man voller Motivation eine Band gründet und seine ersten Schritte tut oder einer verführerischen jungen Dame verfällt – denn manches ändert sich nie. Wer sich grundsätzlich für die angesprochenen Themen interessiert, findet in „Die Welt ist eine Scheibe“ ein fesselnd und ebenso gefühl- wie humorvoll geschriebenes Büchlein, das sich sehr flüssig und schnell liest, richtig Lust macht auf die Musik der Band „Adrenalin“ oder eben ähnlich geartete und neben zu vernachlässigenden Details im Prinzip nur einen Fehler hat: Es ist zu kurz und das offene Ende hinterlässt einen angerührten Leser, der nur zu gerne wissen will, wie es weiterging. Ein gelungenes und sympathisches Debüt, das beweist, dass auch solch kleine Bandgeschichten ohne große Exzesse und klischeebewehrte Ausschlachtungen über viel Charme verfügen und in ihrer Ehrlichkeit, Offenheit und unprätentiösen Bodenständigkeit bestechender sein können als der abgedrehte Nerd-Roman oder die drogen- und sexschwangere Rockbiographie. Das Thema Schule ist ein Dankbares, denn fast jeder war selbst auf einer und ist somit irgendwie mit dem Thema vertraut, erlaubt sich häufig auch Meinungen, und vergleicht seine eigene Schulzeit mit aktuellen Berichten – gerade auch kritischen, Stichwörter „Pisa-Studie“, „Bildungsmisere“, „Rütli-Schule“ -, meist spätestens dann, wenn der eigene Nachwuchs da ist. So stieß auch ich auf Bücher, die sich auf sehr amüsante Weise mit dem aktuellen Schulalltag auseinandersetzen, ob aus Schüler- oder aus Lehrersicht. Besonders Lehrkörper Stephan Serin hatte es mir mit seinen herrlich selbstironischen Bänden „Föhn mich nicht zu“ und „Musstu wissen, weißdu!“ angetan und mich einerseits zu wahren Lachanfällen animiert, mir andererseits aber auch aktuelle Bildungsprobleme vermittelt und zum Nachdenken angeregt. Vor diesem Hintergrund stieß ich kürzlich beim Stöbern in einer Buchhandlung auf „Isch geh Schulhof“ von Philipp Möller, der aus der Erwachsenen-Pädagogik kommt und als Quereinsteiger an einer Grundschule in einem Berliner Kiez landete. Im Gegensatz zum bewusst überzeichneten und komödiantischen Stil Serins vergewissert Möller, dass es bei ihm keinen Unterschied zwischen Erzähler und Autor gäbe, also bis auf die Namen sich alles tatsächlich so abgespielt habe. Und was er nach seinem Sprung ins kalte Wasser zu berichten weiß, ist wahrlich haarsträubend. Seine Schule in einem sog. Problembezirk befindet sich in einem desolaten Zustand und das Bildungsniveau ist erschreckend niedrig. Die zusammengewürfelten Klassen mit Schülern unterschiedlicher Herkunft (bzw. mit Schülern mit Eltern unterschiedlicher Nationalitäten) hinken sämtlichen Lehrplänen hinterher; an normalen Unterricht ist kaum zu denken, denn zunächst einmal müssen die grundlegendsten Benimmregeln vermittelt und die Sprachbarrieren überwunden werden, von ethischen Selbstverständlichkeiten einmal ganz zu schweigen. Möller beschreibt sehr anschaulich die Herausforderungen, vor die er sich gestellt sah und die Probleme nicht nur seiner Schule, sondern im Prinzip des derzeitigen Bildungssystems, adäquat auf diese geänderten Anforderungen zu reagieren. So bekommt der Leser einen sehr praxisorientierten, sicherlich auch stark vereinfachten, aber eben auch veranschaulichenden Einblick in reformistische Ansätze und ihren Sinn. Gleichzeitig entwickelt der Leser ein Bewusstsein – sofern noch nicht vorhanden – für die Ursachen der Lernschwächen und sozialen Inkompetenz von „Problemschülern“, wie sie „Herrn Mülla“ konfrontieren. Diese Abschnitte trafen besonders meinen Nerv, denn frei jeglichen dann unangebrachten Humors und Zynismus scheut er sich weder, mit dem Migrationshintergrund manch Schülers offenbar verbundene Gründe zu benennen, noch xenophoben Ressentiments die Zähne zu ziehen, indem er allgemeine soziale Missstände und Versäumnisse sowie Ungerechtigkeiten des Systems aufzeigt. Ansonsten regiert aber auch gern mal der, bisweilen auch etwas derbere, (Galgen-)Humor, wenn auch weit weniger als beispielsweise in Serins o.g. Büchern. Möller beschreibt darüber hinaus seine Versuche, sich nach anfänglicher Skepsis mit den Gegebenheiten zu arrangieren und seine Arbeit so gut wie möglich zu machen, seine Erfolge, aber auch seine Rückschläge – und seine vermutlich oft als Kampf gegen Windmühlen empfundenen Erfahrungen mit demotivierten bis unfähigen Kolleginnen und Kollegen, den Behörden etc. Auf den Verwaltungsapparat wird kein sonderlich gutes Licht geworfen, wenn man liest, wie einerseits Quereinsteiger ohne jegliche Erfahrung auf die (bzw. vor allem diese) Kinder losgelassen werden, wodurch der Sinn des Lehramtsstudiums natürlich angezweifelt werden darf, und andererseits diese im Idealfall dann motivierten, frischen Nachwuchskräfte schließlich geschasst werden, nachdem sie glaubten, ihre Berufung gefunden zu haben. „Hire & Fire“ im Bildungsbereich – unfassbar und wenig zielführend. Dadurch mutet „Isch geh Schulhof“ bisweilen auch etwas wie eine Abrechnung mit dem starren und ignoranten Schulapparat an, was sich jedoch im akzeptablen und vor allem verständlichen Rahmen hält. Aus seinem antiklerikalen, liberalen/sozialen und freidenkerischen Weltbild macht Möller keinen Hehl und erteilt falscher Toleranz (nämlich der ggü. Intoleranz) klare Absagen, ohne zum verweichlichten Gutmenschen zu werden – ganz im Gegenteil, er legt sich ein erstaunlich dickes Fell zu. All dies natürlich vorausgesetzt dem Fall, dass es Möller mit der Wahrheit hier tatsächlich immer ganz genau nahm. Als störend erweist sich nämlich gerade auch hin und wieder seine Selbstgefälligkeit, nicht selten scheint er sich selbst auf die Schulter zu klopfen und vermischt seine beruflichen und pädagogischen Erfahrungen zudem mit Einblicken in sein Privatleben und seine Sozialisation, und beide erscheinen fast schon befremdlich harmonisch und perfekt, als habe er nie etwas auszustehen gehabt. Tatsächlich entstammt er dem Bildungsbürgertum der Mittelschicht, einer klassischen Lehrerfamilie, und das Schicksal scheint es stets gut mit ihm gemeint zu haben. Jedoch ist sich Möller dessen anscheinend bewusst und zieht in entscheidenden Fragen meines Erachtens meist die richtigen Schlüsse – beispielsweise den, dass ein Buch wie dieses ein durchaus sinnvoller und niedrigschwelliger Beitrag zur Debatte um das Schulsystem und die Bildungspolitik sein kann, und quasi nebenbei eine persönliche Aufarbeitung turbulenter Jahre – oder umgekehrt. Mich hat das Buch jedenfalls gut unterhalten, beginnend auf „Asi-TV-Niveau“, jedoch lediglich, um sein Publikum dort abzuholen und mit ihm gemeinsam hinter die Kulissen zu blicken, Missstände anzuprangern, Widersprüche aufzuzeigen und auszuhalten und Lösungsansätze zu liefern. Dass er dabei, besonders gegen Ende, wie unter Zeitdruck stehend auch noch arg oberflächlich und hektisch Psychologie und Philosophie einbringt, möchte ich seinem Komplettierungseifer zuschreiben und sei ihm verziehen. Seine Selbstgefälligkeit an der Schwelle zur Arroganz wiederum mag – immer noch unter der Prämisse, dass sich tatsächlich alles so wie beschrieben abgespielt hat – seinen ungeahnten und respektablen Erfolgen zuzuschreiben sein, die er unter diesen schwierigen Bedingungen an jener Schule erreicht hat und ihn zunächst sicherlich um Jahre altern lassen, schließlich jedoch klüger und weiser gemacht haben, geschuldet sein, doch so sehr man sich auch darüber freuen darf, über sich selbst hinausgewachsen zu sein, so wäre doch gerade angesichts derart trauriger Schicksale wie derjenigen, derer sich Möller in Form seiner Schüler ausgesetzt sah, etwas Demut angebracht, statt mit seinem intakten Bilderbuch-Familienleben anzugeben. Dies war zumindest mein Empfinden. Kritiker behaupten, Möller habe sich am Erfolg der unter dem Pseudonym „Frau Freitag“ veröffentlichten Blog-Einträge und Bücher zum ähnlichen Thema stark und wenig originell orientiert, was ich nicht beurteilen kann, da ich diese noch nicht kenne – aber gern als Empfehlung mitnehme.
Das Thema Schule ist ein Dankbares, denn fast jeder war selbst auf einer und ist somit irgendwie mit dem Thema vertraut, erlaubt sich häufig auch Meinungen, und vergleicht seine eigene Schulzeit mit aktuellen Berichten – gerade auch kritischen, Stichwörter „Pisa-Studie“, „Bildungsmisere“, „Rütli-Schule“ -, meist spätestens dann, wenn der eigene Nachwuchs da ist. So stieß auch ich auf Bücher, die sich auf sehr amüsante Weise mit dem aktuellen Schulalltag auseinandersetzen, ob aus Schüler- oder aus Lehrersicht. Besonders Lehrkörper Stephan Serin hatte es mir mit seinen herrlich selbstironischen Bänden „Föhn mich nicht zu“ und „Musstu wissen, weißdu!“ angetan und mich einerseits zu wahren Lachanfällen animiert, mir andererseits aber auch aktuelle Bildungsprobleme vermittelt und zum Nachdenken angeregt. Vor diesem Hintergrund stieß ich kürzlich beim Stöbern in einer Buchhandlung auf „Isch geh Schulhof“ von Philipp Möller, der aus der Erwachsenen-Pädagogik kommt und als Quereinsteiger an einer Grundschule in einem Berliner Kiez landete. Im Gegensatz zum bewusst überzeichneten und komödiantischen Stil Serins vergewissert Möller, dass es bei ihm keinen Unterschied zwischen Erzähler und Autor gäbe, also bis auf die Namen sich alles tatsächlich so abgespielt habe. Und was er nach seinem Sprung ins kalte Wasser zu berichten weiß, ist wahrlich haarsträubend. Seine Schule in einem sog. Problembezirk befindet sich in einem desolaten Zustand und das Bildungsniveau ist erschreckend niedrig. Die zusammengewürfelten Klassen mit Schülern unterschiedlicher Herkunft (bzw. mit Schülern mit Eltern unterschiedlicher Nationalitäten) hinken sämtlichen Lehrplänen hinterher; an normalen Unterricht ist kaum zu denken, denn zunächst einmal müssen die grundlegendsten Benimmregeln vermittelt und die Sprachbarrieren überwunden werden, von ethischen Selbstverständlichkeiten einmal ganz zu schweigen. Möller beschreibt sehr anschaulich die Herausforderungen, vor die er sich gestellt sah und die Probleme nicht nur seiner Schule, sondern im Prinzip des derzeitigen Bildungssystems, adäquat auf diese geänderten Anforderungen zu reagieren. So bekommt der Leser einen sehr praxisorientierten, sicherlich auch stark vereinfachten, aber eben auch veranschaulichenden Einblick in reformistische Ansätze und ihren Sinn. Gleichzeitig entwickelt der Leser ein Bewusstsein – sofern noch nicht vorhanden – für die Ursachen der Lernschwächen und sozialen Inkompetenz von „Problemschülern“, wie sie „Herrn Mülla“ konfrontieren. Diese Abschnitte trafen besonders meinen Nerv, denn frei jeglichen dann unangebrachten Humors und Zynismus scheut er sich weder, mit dem Migrationshintergrund manch Schülers offenbar verbundene Gründe zu benennen, noch xenophoben Ressentiments die Zähne zu ziehen, indem er allgemeine soziale Missstände und Versäumnisse sowie Ungerechtigkeiten des Systems aufzeigt. Ansonsten regiert aber auch gern mal der, bisweilen auch etwas derbere, (Galgen-)Humor, wenn auch weit weniger als beispielsweise in Serins o.g. Büchern. Möller beschreibt darüber hinaus seine Versuche, sich nach anfänglicher Skepsis mit den Gegebenheiten zu arrangieren und seine Arbeit so gut wie möglich zu machen, seine Erfolge, aber auch seine Rückschläge – und seine vermutlich oft als Kampf gegen Windmühlen empfundenen Erfahrungen mit demotivierten bis unfähigen Kolleginnen und Kollegen, den Behörden etc. Auf den Verwaltungsapparat wird kein sonderlich gutes Licht geworfen, wenn man liest, wie einerseits Quereinsteiger ohne jegliche Erfahrung auf die (bzw. vor allem diese) Kinder losgelassen werden, wodurch der Sinn des Lehramtsstudiums natürlich angezweifelt werden darf, und andererseits diese im Idealfall dann motivierten, frischen Nachwuchskräfte schließlich geschasst werden, nachdem sie glaubten, ihre Berufung gefunden zu haben. „Hire & Fire“ im Bildungsbereich – unfassbar und wenig zielführend. Dadurch mutet „Isch geh Schulhof“ bisweilen auch etwas wie eine Abrechnung mit dem starren und ignoranten Schulapparat an, was sich jedoch im akzeptablen und vor allem verständlichen Rahmen hält. Aus seinem antiklerikalen, liberalen/sozialen und freidenkerischen Weltbild macht Möller keinen Hehl und erteilt falscher Toleranz (nämlich der ggü. Intoleranz) klare Absagen, ohne zum verweichlichten Gutmenschen zu werden – ganz im Gegenteil, er legt sich ein erstaunlich dickes Fell zu. All dies natürlich vorausgesetzt dem Fall, dass es Möller mit der Wahrheit hier tatsächlich immer ganz genau nahm. Als störend erweist sich nämlich gerade auch hin und wieder seine Selbstgefälligkeit, nicht selten scheint er sich selbst auf die Schulter zu klopfen und vermischt seine beruflichen und pädagogischen Erfahrungen zudem mit Einblicken in sein Privatleben und seine Sozialisation, und beide erscheinen fast schon befremdlich harmonisch und perfekt, als habe er nie etwas auszustehen gehabt. Tatsächlich entstammt er dem Bildungsbürgertum der Mittelschicht, einer klassischen Lehrerfamilie, und das Schicksal scheint es stets gut mit ihm gemeint zu haben. Jedoch ist sich Möller dessen anscheinend bewusst und zieht in entscheidenden Fragen meines Erachtens meist die richtigen Schlüsse – beispielsweise den, dass ein Buch wie dieses ein durchaus sinnvoller und niedrigschwelliger Beitrag zur Debatte um das Schulsystem und die Bildungspolitik sein kann, und quasi nebenbei eine persönliche Aufarbeitung turbulenter Jahre – oder umgekehrt. Mich hat das Buch jedenfalls gut unterhalten, beginnend auf „Asi-TV-Niveau“, jedoch lediglich, um sein Publikum dort abzuholen und mit ihm gemeinsam hinter die Kulissen zu blicken, Missstände anzuprangern, Widersprüche aufzuzeigen und auszuhalten und Lösungsansätze zu liefern. Dass er dabei, besonders gegen Ende, wie unter Zeitdruck stehend auch noch arg oberflächlich und hektisch Psychologie und Philosophie einbringt, möchte ich seinem Komplettierungseifer zuschreiben und sei ihm verziehen. Seine Selbstgefälligkeit an der Schwelle zur Arroganz wiederum mag – immer noch unter der Prämisse, dass sich tatsächlich alles so wie beschrieben abgespielt hat – seinen ungeahnten und respektablen Erfolgen zuzuschreiben sein, die er unter diesen schwierigen Bedingungen an jener Schule erreicht hat und ihn zunächst sicherlich um Jahre altern lassen, schließlich jedoch klüger und weiser gemacht haben, geschuldet sein, doch so sehr man sich auch darüber freuen darf, über sich selbst hinausgewachsen zu sein, so wäre doch gerade angesichts derart trauriger Schicksale wie derjenigen, derer sich Möller in Form seiner Schüler ausgesetzt sah, etwas Demut angebracht, statt mit seinem intakten Bilderbuch-Familienleben anzugeben. Dies war zumindest mein Empfinden. Kritiker behaupten, Möller habe sich am Erfolg der unter dem Pseudonym „Frau Freitag“ veröffentlichten Blog-Einträge und Bücher zum ähnlichen Thema stark und wenig originell orientiert, was ich nicht beurteilen kann, da ich diese noch nicht kenne – aber gern als Empfehlung mitnehme.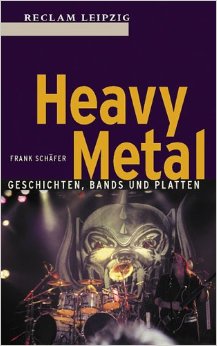 Nachdem ich Frank Schäfer durch seine Anekdotensammlung „Metal Störies“, die mich prächtig unterhalten konnte, kennengelernt hatte, habe ich mal recherchiert, was der Braunschweiger „Rolling Stone“- und „taz“-Journalist darüber hinaus an Büchern zum Thema Musik veröffentlicht hat. Zu seinen diesbezüglichen Frühwerken ist „Heavy Metal – Geschichten, Bands und Platten“ aus dem Jahr 2001 zu zählen, das sich grob in vier Abschnitte unterteilen lässt: Eine allgemeine, immer noch etwas oberflächliche und in Detailfragen sicherlich streitbare, ansonsten aber gelungene und informative Abhandlung zur Entwicklung und Geschichte des Musik-Genres, eine ausführliche, kritische Vorstellung der nach Schäfers Meinung sieben wichtigsten Bands, einige Plattenkritiken (exemplarische Klassiker als Streifzug durch seine Plattensammlung sowie zum Veröffentlichungszeitpunkt aktuelle Scheiben) und ein paar Konzertberichte. Leider bedient sich Schäfer unverständlicherweise eines angeberischen, vollkommen übertriebenen Geschwurbels, das möglichst viele weitestgehend unbekannte Vokabeln unterzubringen versucht. Wie überflüssig das tatsächlich ist, wird dadurch deutlich, dass seine Texte auch weitestgehend problemlos zu verstehen sind, ohne die Bedeutung seiner Spracheskapaden zu kennen. Das wiederum ist natürlich ein Pluspunkt, denn dadurch lassen sich seine durchaus unterhaltsamen und humorvollen, mit einer gewissen, aber nie abwertenden Ironie für sich selbst und das Genre versehenen Kapitel zügig konsumieren und dank Schäfers Meinungsfreudigkeit aus Fan-Sicht nickend bestätigen oder auch kopfschüttelnd ablehnen. Ein paar offensichtliche Fehler („Grunge“ entstammt nicht der Mittelschicht, wurde dieser mittels MTV & Co. aber massiv dargereicht, so dass zumindest die Speerspitze der „Bewegung“ Gefahr lief, von weißen Mittelklasse-Trendkonsum-Kids überlaufen zu werden; nicht „Strange World“, sondern „Invasion“ der Iron-Maiden-„Soundhouse Tapes“ wurde erst viel später noch einmal veröffentlicht) gehen natürlich mit den üblichen Geschmacksfragen einher. So musste ich gerade bei der ungewohnt kritischen Auseinandersetzung mit der „Black Sabbath“-Diskografie ziemlich schmunzeln und konnte vieles nachvollziehen, wenngleich ich „War Pigs“ für einen geilen Song halte. Von schwerer Geschmacksverirrung muss jedoch ausgegangen werden, wenn Schäfer dem Album „Dehumanizer“ jegliche Qualitäten abspricht. Auch irritiert doch stark, wenn er ausgerechnet „Seventh Star“ als einziges durchweg gelungenes „Black Sabbath“-Album bezeichnet; natürlich hat er ein Recht auf sein Lieblingsalbum, jedoch impliziert dies, ein „Headless Cross“ beispielsweise würde Füllsongs enthalten, was natürlich jeder Grundlage entbehrt – wie auch jegliche über den Sound hinausgehende Kritik am Iron-Maiden-Götterwerk „Seventh Son of a Seventh Son“, womit sich Schäfer jedoch in unrühmlicher Gesellschaft so vieler Musikkritiker befindet, die seinerzeit möglicherweise bereits zu alt waren, um für die besondere Magie dieses Albums empfänglich zu sein und der simplen Versuchung erlagen, es mit normalen Maßstäben messen zu wollen, dadurch keinen Zugang fanden. Wenn man dann andererseits lesen muss, wie Schäfer viel zu viel Southern Rock abfeiert, weiß man spätestens, dass da eben manchmal allzu sehr der kleine Redneck in ihm mit ihm durchgeht, der sonst erfrischend ehrlich verkopftes Prog-Gefrickel und verkifften Hippie-Blues kritisiert. Wenn er Kiss‘ „Space Ace“ mit „All-Atze“ übersetzt, muss ich lachen, wenn ich erfahre, dass er zum „Monsters of Rock“-Festival 1988 pilgerte, ohne sich Headliner Iron Maiden anzusehen, bleibt mir jedoch nur noch, die Hände überm Kopf zusammenzuschlagen (ich hätte mir damals ein Bein ausgerissen, um dabeisein zu dürfen). Seine eigene, höchst obskure Metal-Band „Salem’s Law“, mit der er in den späten ’80ern unterwegs war, erwähnt er hier übrigens noch mit keiner Silbe, aber gerade in den anekdotenreichen Konzertberichten ist bereits sein schöner Stil erkennbar, den ich bei „Metal Störies“ zu schätzen gelernt habe. Ein insgesamt durchschnittliches, dabei trotz allem sympathisches Buch für Genre-Affine, das jedoch in seinen Bewertungen nicht ernstgenommen werden und niemanden davon abhalten sollte, sich die erwähnten Alben selbst anzuhören. Drei weitere Frank-Schäfer-Schmöker sind bereits geordert.
Nachdem ich Frank Schäfer durch seine Anekdotensammlung „Metal Störies“, die mich prächtig unterhalten konnte, kennengelernt hatte, habe ich mal recherchiert, was der Braunschweiger „Rolling Stone“- und „taz“-Journalist darüber hinaus an Büchern zum Thema Musik veröffentlicht hat. Zu seinen diesbezüglichen Frühwerken ist „Heavy Metal – Geschichten, Bands und Platten“ aus dem Jahr 2001 zu zählen, das sich grob in vier Abschnitte unterteilen lässt: Eine allgemeine, immer noch etwas oberflächliche und in Detailfragen sicherlich streitbare, ansonsten aber gelungene und informative Abhandlung zur Entwicklung und Geschichte des Musik-Genres, eine ausführliche, kritische Vorstellung der nach Schäfers Meinung sieben wichtigsten Bands, einige Plattenkritiken (exemplarische Klassiker als Streifzug durch seine Plattensammlung sowie zum Veröffentlichungszeitpunkt aktuelle Scheiben) und ein paar Konzertberichte. Leider bedient sich Schäfer unverständlicherweise eines angeberischen, vollkommen übertriebenen Geschwurbels, das möglichst viele weitestgehend unbekannte Vokabeln unterzubringen versucht. Wie überflüssig das tatsächlich ist, wird dadurch deutlich, dass seine Texte auch weitestgehend problemlos zu verstehen sind, ohne die Bedeutung seiner Spracheskapaden zu kennen. Das wiederum ist natürlich ein Pluspunkt, denn dadurch lassen sich seine durchaus unterhaltsamen und humorvollen, mit einer gewissen, aber nie abwertenden Ironie für sich selbst und das Genre versehenen Kapitel zügig konsumieren und dank Schäfers Meinungsfreudigkeit aus Fan-Sicht nickend bestätigen oder auch kopfschüttelnd ablehnen. Ein paar offensichtliche Fehler („Grunge“ entstammt nicht der Mittelschicht, wurde dieser mittels MTV & Co. aber massiv dargereicht, so dass zumindest die Speerspitze der „Bewegung“ Gefahr lief, von weißen Mittelklasse-Trendkonsum-Kids überlaufen zu werden; nicht „Strange World“, sondern „Invasion“ der Iron-Maiden-„Soundhouse Tapes“ wurde erst viel später noch einmal veröffentlicht) gehen natürlich mit den üblichen Geschmacksfragen einher. So musste ich gerade bei der ungewohnt kritischen Auseinandersetzung mit der „Black Sabbath“-Diskografie ziemlich schmunzeln und konnte vieles nachvollziehen, wenngleich ich „War Pigs“ für einen geilen Song halte. Von schwerer Geschmacksverirrung muss jedoch ausgegangen werden, wenn Schäfer dem Album „Dehumanizer“ jegliche Qualitäten abspricht. Auch irritiert doch stark, wenn er ausgerechnet „Seventh Star“ als einziges durchweg gelungenes „Black Sabbath“-Album bezeichnet; natürlich hat er ein Recht auf sein Lieblingsalbum, jedoch impliziert dies, ein „Headless Cross“ beispielsweise würde Füllsongs enthalten, was natürlich jeder Grundlage entbehrt – wie auch jegliche über den Sound hinausgehende Kritik am Iron-Maiden-Götterwerk „Seventh Son of a Seventh Son“, womit sich Schäfer jedoch in unrühmlicher Gesellschaft so vieler Musikkritiker befindet, die seinerzeit möglicherweise bereits zu alt waren, um für die besondere Magie dieses Albums empfänglich zu sein und der simplen Versuchung erlagen, es mit normalen Maßstäben messen zu wollen, dadurch keinen Zugang fanden. Wenn man dann andererseits lesen muss, wie Schäfer viel zu viel Southern Rock abfeiert, weiß man spätestens, dass da eben manchmal allzu sehr der kleine Redneck in ihm mit ihm durchgeht, der sonst erfrischend ehrlich verkopftes Prog-Gefrickel und verkifften Hippie-Blues kritisiert. Wenn er Kiss‘ „Space Ace“ mit „All-Atze“ übersetzt, muss ich lachen, wenn ich erfahre, dass er zum „Monsters of Rock“-Festival 1988 pilgerte, ohne sich Headliner Iron Maiden anzusehen, bleibt mir jedoch nur noch, die Hände überm Kopf zusammenzuschlagen (ich hätte mir damals ein Bein ausgerissen, um dabeisein zu dürfen). Seine eigene, höchst obskure Metal-Band „Salem’s Law“, mit der er in den späten ’80ern unterwegs war, erwähnt er hier übrigens noch mit keiner Silbe, aber gerade in den anekdotenreichen Konzertberichten ist bereits sein schöner Stil erkennbar, den ich bei „Metal Störies“ zu schätzen gelernt habe. Ein insgesamt durchschnittliches, dabei trotz allem sympathisches Buch für Genre-Affine, das jedoch in seinen Bewertungen nicht ernstgenommen werden und niemanden davon abhalten sollte, sich die erwähnten Alben selbst anzuhören. Drei weitere Frank-Schäfer-Schmöker sind bereits geordert.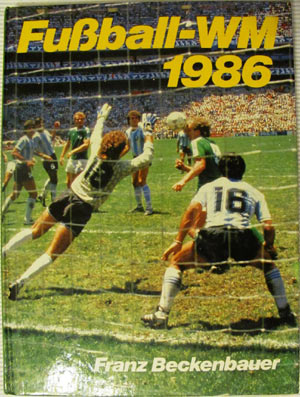 Das war ja die erste WM (Mexico!), die ich seinerzeit so am Rande mitbekam. War interessant, das alles mal nachzulesen und mir die schönen alten Bilder anzusehen, von denen das Buch sehr viele im Großformat enthält. Gut geschrieben ist’s allemal, wenn auch anscheinend nur wenige Texte wirklich von Beckenbauer stammen. Hatte ich mal für 2,- EUR aus ’ner Art Trödelladen mitgenommen und mir als Strandlektüre eingepackt.
Das war ja die erste WM (Mexico!), die ich seinerzeit so am Rande mitbekam. War interessant, das alles mal nachzulesen und mir die schönen alten Bilder anzusehen, von denen das Buch sehr viele im Großformat enthält. Gut geschrieben ist’s allemal, wenn auch anscheinend nur wenige Texte wirklich von Beckenbauer stammen. Hatte ich mal für 2,- EUR aus ’ner Art Trödelladen mitgenommen und mir als Strandlektüre eingepackt. Nachdem ich einen Schmöker über die WM ’86 gelesen hatte, griff ich zu Valériens Retrospektive der EM ’88 in Deutschland, die ich als Knirps tatsächlich über weite Strecken am Fernsehgerät verfolgt hatte. Auch dieser Band mit vielen Bildern wurde gut und unterhaltsam und vor allem fair allen Mannschaften gegenüber geschrieben und ließ mich meine Erinnerungen auffrischen. Irland hatte ja damals gegen England 1:0 gewonnen; ein geschichtsträchtiges Ereignis, das ich gar nicht mehr auf Schirm hatte. Extra Kapitel wurden interessanterweise dem Phänomen des Hooliganismus gewidmet und Gastautor Herbert Riehl-Heyse brachte einen überraschend kritischen Artikel über die möglichen Ursachen unter, an anderer Stelle jedoch wird das Thema wieder sehr oberflächlich behandelt. Interessant auch der mehrseitige Abschnitt über die Entwicklung der Europameisterschaft als regelmäßiges Turnier und die vorausgegangenen Turniere mit ihren jeweiligen Siegern und Verlierern. Dass man Ronald Koemans extrem unsportliche Geste nach dem Halbfinalspiel gegen Deutschland mit keiner Silbe erwähnt, irritiert mich jedoch sehr.
Nachdem ich einen Schmöker über die WM ’86 gelesen hatte, griff ich zu Valériens Retrospektive der EM ’88 in Deutschland, die ich als Knirps tatsächlich über weite Strecken am Fernsehgerät verfolgt hatte. Auch dieser Band mit vielen Bildern wurde gut und unterhaltsam und vor allem fair allen Mannschaften gegenüber geschrieben und ließ mich meine Erinnerungen auffrischen. Irland hatte ja damals gegen England 1:0 gewonnen; ein geschichtsträchtiges Ereignis, das ich gar nicht mehr auf Schirm hatte. Extra Kapitel wurden interessanterweise dem Phänomen des Hooliganismus gewidmet und Gastautor Herbert Riehl-Heyse brachte einen überraschend kritischen Artikel über die möglichen Ursachen unter, an anderer Stelle jedoch wird das Thema wieder sehr oberflächlich behandelt. Interessant auch der mehrseitige Abschnitt über die Entwicklung der Europameisterschaft als regelmäßiges Turnier und die vorausgegangenen Turniere mit ihren jeweiligen Siegern und Verlierern. Dass man Ronald Koemans extrem unsportliche Geste nach dem Halbfinalspiel gegen Deutschland mit keiner Silbe erwähnt, irritiert mich jedoch sehr. Auch diesen Schmöker hab ich vom Trödel mitgenommen und meine Lieblings-WM noch einmal Revue passieren lassen. Schön, die Erinnerungen noch einmal aufzufrischen, gerade auch in Bezug auf die anderen Mannschaften. Die Vorrunde allerdings wird relativ kurz abgefrühstückt, damit’s kein allzu dicker Wälzer wurde. Im Bericht über eines der spannendsten Länderspiele schlechthin, das Halbfinale zwischen England und Deutschland, die nervenaufreibenden Pfostenschüsse unerwähnt zu lassen, verstehe ich nicht ganz. Irritierend auch, dass die Vorstellungen der einzelnen Nationalmannschaften offenbar vor Turnierbeginn verfasst, aber ans Ende des Buches gesetzt wurden. Auffallend finde ich, wie mehrmals auf das damals noch immer hochbrisante Thema der Fußballgewalt mit Todesfällen eingegangen wird und wie hier und da Kritik laut wird, beispielsweise an der Eintrittskartenvergabe. Generell werden negative Ereignisse, Entscheidungen und Dinge recht konrekt beim Namen genannt. Statistiken etc. runden das Werk ab.
Auch diesen Schmöker hab ich vom Trödel mitgenommen und meine Lieblings-WM noch einmal Revue passieren lassen. Schön, die Erinnerungen noch einmal aufzufrischen, gerade auch in Bezug auf die anderen Mannschaften. Die Vorrunde allerdings wird relativ kurz abgefrühstückt, damit’s kein allzu dicker Wälzer wurde. Im Bericht über eines der spannendsten Länderspiele schlechthin, das Halbfinale zwischen England und Deutschland, die nervenaufreibenden Pfostenschüsse unerwähnt zu lassen, verstehe ich nicht ganz. Irritierend auch, dass die Vorstellungen der einzelnen Nationalmannschaften offenbar vor Turnierbeginn verfasst, aber ans Ende des Buches gesetzt wurden. Auffallend finde ich, wie mehrmals auf das damals noch immer hochbrisante Thema der Fußballgewalt mit Todesfällen eingegangen wird und wie hier und da Kritik laut wird, beispielsweise an der Eintrittskartenvergabe. Generell werden negative Ereignisse, Entscheidungen und Dinge recht konrekt beim Namen genannt. Statistiken etc. runden das Werk ab.