 Der Spiegel-Verlag brachte im Jahre 2006 dieses Sonderheft heraus, das sich auf 180 Seiten (abzgl. diverser Werbung) ausschließlich der spannenden Zeit des ersten deutschen Nachkriegsjahrzehnts widmet. Verschiedene Autoren widmeten sich verschiedenen Themenbereichen und ebenso unterschiedlich sind auch Informationsgehalt und Qualität zu bewerten. Klaus Wiegrefe steigt mit den Gründerjahren ein, gefolgt von einem Interview mit Altkanzler Helmut Schmidt. Reich bebildert sind viele Seiten, die einen Überblick über geschichtsträchtige Gebäude und Orte bieten. Viel wird auf die Rolle Konrad Adenauers eingegangen, wobei man für meinen Geschmack zu viele Seiten zu lang recht unkritisch bleibt. Kürzere Essays, z.B. über die versäumte Aufarbeitung von Kriegstraumata einer ganzen Generation, über jüdische Displaced Persons, Versuche der Aussöhnung mit Israel und deutsche US-Emigranten werden zwischengeschoben und reißen interessante Perspektiven an, die sicherlich eine tiefergehende Auseinandersetzung rechtfertigen würden. Großen Raum nehmen folgerichtig der schnell entfachte Kalte Krieg und die mit ihm einhergehenden Zugeständnisse an die Bevölkerung und alte Nazi-Schergen ein. Nachdenklich stimmt beispielsweise ein Artikel über den Krupp-Konzern und wie er sich aus seiner Verantwortung stehlen konnte. Deutsche Flüchtlinge und Vertriebene sind ebenso Thema wie die unfassbaren Attacken der katholischen Kirche gegen die evangelische und die theologischen Differenzen des Jahrzehnts, bei denen die Katholiken nicht gut wegkommen. Zur von verschiedenen Autoren beleuchteten Personalie Adenauer gesellt sich ein kritischer Blick auf den „Vater des Wirtschaftswunders“ Ludwig Erhard, dessen Mythos ein gutes Stück weit auseinandergenommen wird – denn so „sozial“ wie heutzutage insbesondere von SPD-„Genossen“ gern kolportiert, war seine Marktwirtschaft mitnichten. Daraus resultierend und überaus lesenswert ist Geschichtsprofessor Hans-Ulrich Wehlers Aufräumen mit dem wirtschaftlichen „Wachstumsfetischismus“, der immer wieder das „Wirtschaftswunder“ nostalgisch verklärt und dem Wunschtraum nachhängt, derartige Wirtschaftswachstumszahlen noch einmal erreichen zu können – gern auch als Argumentation im Klassenkampf von oben gegen die Unterschicht eingesetzt. Relativ ausführlich widmet man sich der größten Schande der deutschen Nachkriegsgeschichte, der versäumten Entnazifizierung – nicht ohne die „Sachzwänge“, die dazu ihren entscheidenden Teil beitrugen, gegenüberzustellen, ohne jedoch den damit einhergehenden Zynismus in vollem Umfang zu verdeutlichen und zu verurteilen. Vielleicht war das auch gar nicht nötig, denn es liest sich auch so beschämend genug. Die beschriebenen Schwierigkeiten für deutsche Kriegsheimkehrer, wieder in der Gesellschaft Fuß zu fassen, entbehren hingegen nicht einer gewissen Tragik. Wie ein Lichtblick erscheint da die breite Protestbewegung gegen Wiederbewaffnung und Westbindung, die das Spiegel special korrekt als Wendepunkt der politischen Kultur einordnet. Auf lediglich zwei Seiten tendenziell als eher abgefrühstückt hingegen empfinde ich Alexander Szandars Ausführungen zur von Adenauer flugs vorangetriebenen Wiederbewaffnung. Eher einseitig, dennoch in ihrem zusammenfassenden Charakter alles andere als uninteressant fallen unterdessen die Berichte über die Luftbrücke und ihre „Rosinenbomber“ aus. Und auch das Thema der deutsch-deutschen Spionage hätte auch in diesem begrenzten Rahmen wesentlich mehr Stoff als für nur eine Doppelseite geboten. Da verwundert es auch kaum, dass die komplexe und spannende Thematik der DDR nur in aller Kürze, am Rande und extrem einseitig abgehandelt wird – eines der größten Versäumnisse dieser Publikation.
Der Spiegel-Verlag brachte im Jahre 2006 dieses Sonderheft heraus, das sich auf 180 Seiten (abzgl. diverser Werbung) ausschließlich der spannenden Zeit des ersten deutschen Nachkriegsjahrzehnts widmet. Verschiedene Autoren widmeten sich verschiedenen Themenbereichen und ebenso unterschiedlich sind auch Informationsgehalt und Qualität zu bewerten. Klaus Wiegrefe steigt mit den Gründerjahren ein, gefolgt von einem Interview mit Altkanzler Helmut Schmidt. Reich bebildert sind viele Seiten, die einen Überblick über geschichtsträchtige Gebäude und Orte bieten. Viel wird auf die Rolle Konrad Adenauers eingegangen, wobei man für meinen Geschmack zu viele Seiten zu lang recht unkritisch bleibt. Kürzere Essays, z.B. über die versäumte Aufarbeitung von Kriegstraumata einer ganzen Generation, über jüdische Displaced Persons, Versuche der Aussöhnung mit Israel und deutsche US-Emigranten werden zwischengeschoben und reißen interessante Perspektiven an, die sicherlich eine tiefergehende Auseinandersetzung rechtfertigen würden. Großen Raum nehmen folgerichtig der schnell entfachte Kalte Krieg und die mit ihm einhergehenden Zugeständnisse an die Bevölkerung und alte Nazi-Schergen ein. Nachdenklich stimmt beispielsweise ein Artikel über den Krupp-Konzern und wie er sich aus seiner Verantwortung stehlen konnte. Deutsche Flüchtlinge und Vertriebene sind ebenso Thema wie die unfassbaren Attacken der katholischen Kirche gegen die evangelische und die theologischen Differenzen des Jahrzehnts, bei denen die Katholiken nicht gut wegkommen. Zur von verschiedenen Autoren beleuchteten Personalie Adenauer gesellt sich ein kritischer Blick auf den „Vater des Wirtschaftswunders“ Ludwig Erhard, dessen Mythos ein gutes Stück weit auseinandergenommen wird – denn so „sozial“ wie heutzutage insbesondere von SPD-„Genossen“ gern kolportiert, war seine Marktwirtschaft mitnichten. Daraus resultierend und überaus lesenswert ist Geschichtsprofessor Hans-Ulrich Wehlers Aufräumen mit dem wirtschaftlichen „Wachstumsfetischismus“, der immer wieder das „Wirtschaftswunder“ nostalgisch verklärt und dem Wunschtraum nachhängt, derartige Wirtschaftswachstumszahlen noch einmal erreichen zu können – gern auch als Argumentation im Klassenkampf von oben gegen die Unterschicht eingesetzt. Relativ ausführlich widmet man sich der größten Schande der deutschen Nachkriegsgeschichte, der versäumten Entnazifizierung – nicht ohne die „Sachzwänge“, die dazu ihren entscheidenden Teil beitrugen, gegenüberzustellen, ohne jedoch den damit einhergehenden Zynismus in vollem Umfang zu verdeutlichen und zu verurteilen. Vielleicht war das auch gar nicht nötig, denn es liest sich auch so beschämend genug. Die beschriebenen Schwierigkeiten für deutsche Kriegsheimkehrer, wieder in der Gesellschaft Fuß zu fassen, entbehren hingegen nicht einer gewissen Tragik. Wie ein Lichtblick erscheint da die breite Protestbewegung gegen Wiederbewaffnung und Westbindung, die das Spiegel special korrekt als Wendepunkt der politischen Kultur einordnet. Auf lediglich zwei Seiten tendenziell als eher abgefrühstückt hingegen empfinde ich Alexander Szandars Ausführungen zur von Adenauer flugs vorangetriebenen Wiederbewaffnung. Eher einseitig, dennoch in ihrem zusammenfassenden Charakter alles andere als uninteressant fallen unterdessen die Berichte über die Luftbrücke und ihre „Rosinenbomber“ aus. Und auch das Thema der deutsch-deutschen Spionage hätte auch in diesem begrenzten Rahmen wesentlich mehr Stoff als für nur eine Doppelseite geboten. Da verwundert es auch kaum, dass die komplexe und spannende Thematik der DDR nur in aller Kürze, am Rande und extrem einseitig abgehandelt wird – eines der größten Versäumnisse dieser Publikation.
Voller Russenklischees steckt Jürgen Dahlkamps Erzählung „WG mit dem Iwan“, in der es um russische Soldaten geht, die während der Besatzung bei deutschen Familien einzogen – anhand eines einzelnen Beispiels. Das ist stereotypisch einerseits, aber eben doch ob seiner Bizarrerie voller Humor und zudem zutiefst menschlich, fast wie ein Beitrag zur Völkerverständigung. Auflockernd wirkt es dann nach aller politischen Schwere ebenfalls, wenn sich Hellmuth Karasek – eigentlich selbst ein Konservativer – mit süffisantem Humor entlarvend der Alltags- und Populärkultur der 1950er widmet, die bestimmt war von der Sehnsucht nach „Normalität“ und heiler Welt. Mathias Schreibers Erörterung der „neuen Einfachheit“ in Literatur und Architektur hingegen erscheint mir eher hypothetisch und wenig allgemeingültig, auch Susanne Beyer scheint mir in ihrem Bemühen, die Stilsuche und -unsicherheit der Angehörigen einer ganzen Nation von oben herab einfachen Formeln zu- und Erklärungen unterzuordnen, etwas fragwürdig. Henryk M. Broder ordnet derweil die Südtirol-Begeisterung der Nachkriegsdeutschen gesellschaftspolitisch ein, was – wie so oft bei ihm – den unangenehmen Nachgeschmack einer nur unzureichend kaschierten tendenziösen Polemik hat, deren Allgemeingültigkeit angezweifelt werden sollte. Von besonderem Interesse waren für mich natürlich Urs Jennys Zeilen zum deutschen Nachkriegskino, das in der BRD von Heimatfilmen und Artverwandtem bestimmt war. Viel Neues bietet der Artikel indes nicht und klammert wieder einmal die DDR nahezu komplett aus – eine vertane Chance. Höhepunkt dieser sich nur indirekt mit Politik auseinandersetzen Artikelreihe im letzten Heftabschnitt ist jedoch insbesondere für mich als Fußball-Fan Jürgen Leinemanns Beschäftigung mit dem „Wunder von Bern“, was erfreulich differenziert und angereichert mit unpopulären Details geschieht und dabei doch viel Respekt vor dem Fußballsport erkennen lässt und ein Gefühl dafür vermittelt, was auf friedliche Weise durch Sport erreicht werden kann, was möglich wird, wenn ein Volk generationsübergreifend zu positiven Identifikationsmöglichkeiten zurückfindet, die sich außerhalb von Politik, Mord und Totschlag finden und trotz ihres spielerischen Charakters ungekünstelt und authentisch im Gegensatz zu gänzlich realitätsentführendem Kitsch sind.
Damit sind zwar viele, aber längst nicht alle Themengebiete genannt, die diese Zeitschrift abdeckt. Mit einigen Abstrichen ist sie sicherlich für einen relativ breiten Überblick über die behandelte Epoche der BRD geeignet. Die Autoren- und damit auch Stilvielfalt, die zudem mit einem gewissen stets um kritische Distanz bemühten Meinungsallerlei (innerhalb eines klar abgesteckten staatstragenden Rahmens) einhergeht, ist nicht frei von einigen Wiederholungen, während die unterschiedlichen Perspektiven einerseits etwas anstrengen, aber auch als Chance zur eigenen Meinungsbildung begriffen werden können. Auch aufgrund meines Vorwissens war mir eine Lesart, die nach Umblättern der letzten Seite in erster Linie Respekt vor der Aufbau- und Wirtschaftsleistung der BRD in den 1950ern einflößt, jedoch nicht möglich und auch wenn die Titelseite dies vielleicht aus Verkaufsgründen suggeriert, dürfte dies auch tatsächlich nicht die oberste Priorität der Publikation gewesen sein. Bei mir persönlich weckte sie im Gegenteil vor allem gesteigertes Verständnis für all jene, die bis heute damit Schwierigkeiten haben, sich wie selbstverständlich mit dem Nachkriegsdeutschland zu identifizieren.
 2012 erschienener, gebundener Geschenkband des beliebten, omnipräsenten Cartoonisten Uli Stein aus dem Lappan-Verlag, das zahlreiche, sich auf einzelne Seiten beschränkende Comic-Gags zum Thema Feiern enthält und darüber hinaus mit nicht ganz ernstgemeinten Ratschlägen und Produktvorschlägen angereichert wurde. Manch müder Witz hat sich eingeschlichen, aber auch einige echte Lacher sind dabei und allgemein lässt sich viel schmunzeln. Obacht jedoch: Stein setzt sich vornehmlich mit typischen Spießer-Feiern auseinander, es geht also mehr um Themen wie Büffet und Etikette als ums Komasaufen oder Ausrasten. Und hier und da hätte vielleicht ein Lektor über die Texte schauen sollen.
2012 erschienener, gebundener Geschenkband des beliebten, omnipräsenten Cartoonisten Uli Stein aus dem Lappan-Verlag, das zahlreiche, sich auf einzelne Seiten beschränkende Comic-Gags zum Thema Feiern enthält und darüber hinaus mit nicht ganz ernstgemeinten Ratschlägen und Produktvorschlägen angereichert wurde. Manch müder Witz hat sich eingeschlichen, aber auch einige echte Lacher sind dabei und allgemein lässt sich viel schmunzeln. Obacht jedoch: Stein setzt sich vornehmlich mit typischen Spießer-Feiern auseinander, es geht also mehr um Themen wie Büffet und Etikette als ums Komasaufen oder Ausrasten. Und hier und da hätte vielleicht ein Lektor über die Texte schauen sollen.
 Grafiker und Karikaturist Ernst Volland veröffentlichte über den Rowohl-Verlag 1983 dieses Comic-Buch, das in recht einfachem, krakeligem Schwarzweiß-Zeichenstil kurze, sich über wenige Seiten erstreckende Anekdoten aus dem Leben des frechen, arbeitsscheuen Punks Friedhelm erzählt, für den Volland Sympathien hegt, die bisweilen aber auch selbstironisch bzw. selbstkritisch ausfallen. Nicht jede Pointe sitzt, der Großteil jedoch ist lustig und bissig genug, um kurzweilig gut zu unterhalten. Eine Art Ausläufer des Humors der ’68er-Generation, der sich der über Sponti-Bewegungen u.ä. schließlich der Punk-Subkultur öffnete.
Grafiker und Karikaturist Ernst Volland veröffentlichte über den Rowohl-Verlag 1983 dieses Comic-Buch, das in recht einfachem, krakeligem Schwarzweiß-Zeichenstil kurze, sich über wenige Seiten erstreckende Anekdoten aus dem Leben des frechen, arbeitsscheuen Punks Friedhelm erzählt, für den Volland Sympathien hegt, die bisweilen aber auch selbstironisch bzw. selbstkritisch ausfallen. Nicht jede Pointe sitzt, der Großteil jedoch ist lustig und bissig genug, um kurzweilig gut zu unterhalten. Eine Art Ausläufer des Humors der ’68er-Generation, der sich der über Sponti-Bewegungen u.ä. schließlich der Punk-Subkultur öffnete.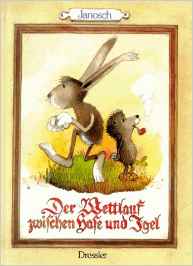 Vergnügliche Variante der berühmten, in Buxtehude spielenden Fabel aus der Feder des beliebten Kinderbuch-Autors Janosch aus dem Jahre 1984. Der Hase fordert den Igel heraus und hetzt durch Städte wie Brehm, Olmburch und Hammurch, während der Igel den Wettlauf schon längst wieder vergessen hat und Müßiggang sowie Geselligkeit mit seiner Frau genießt. Der Hase indes verletzt sich während seines Rennens und wird von Zweifeln geplagt, ob ihn der Igel nicht vielleicht hereinlege. Janosch nimmt auf diese Weise krankhaften Ehrgeiz aufs Korn und spricht ein Plädoyer für all diejenigen aus, die an so etwas überhaupt kein Interesse haben und sich lieber den Annehmlichkeiten des Lebens widmen. Die rund 30 Seiten lesen sich überaus sympathisch und wurden großflächig in Janoschs unverkennbarem Zeichenstil illustriert. Mein Exemplar ist im Dressler-Verlag erschienen.
Vergnügliche Variante der berühmten, in Buxtehude spielenden Fabel aus der Feder des beliebten Kinderbuch-Autors Janosch aus dem Jahre 1984. Der Hase fordert den Igel heraus und hetzt durch Städte wie Brehm, Olmburch und Hammurch, während der Igel den Wettlauf schon längst wieder vergessen hat und Müßiggang sowie Geselligkeit mit seiner Frau genießt. Der Hase indes verletzt sich während seines Rennens und wird von Zweifeln geplagt, ob ihn der Igel nicht vielleicht hereinlege. Janosch nimmt auf diese Weise krankhaften Ehrgeiz aufs Korn und spricht ein Plädoyer für all diejenigen aus, die an so etwas überhaupt kein Interesse haben und sich lieber den Annehmlichkeiten des Lebens widmen. Die rund 30 Seiten lesen sich überaus sympathisch und wurden großflächig in Janoschs unverkennbarem Zeichenstil illustriert. Mein Exemplar ist im Dressler-Verlag erschienen. Die Erzählung „Die Verwandlung“ des deutschsprachigen Schriftstellers Franz Kafka ist mit ihrem Umfang von rund 70 Seiten (im vorliegenden Band: 77 Seiten) die längste seiner in sich abgeschlossenen und noch zu seinen Lebzeiten veröffentlichten. Erstveröffentlicht 1915, gilt sie heute als einer der großen literarischen Klassiker jener Epoche. Sie handelt vom Handelsreisenden Gregor Samsa, der eines Morgens aufwacht und feststellen muss, sich in ein schabenartiges Insekt verwandelt zu haben, woraufhin er seinen Dienst nicht mehr antreten kann und von seiner Familie in seinem Zimmer vor der Öffentlichkeit versteckt gehalten wird. In der Erzählung wird Samsas Existenz vornehmlich aus seiner subjektiven Sicht geschildert, ohne ihn jedoch als Erzähler einzusetzen.
Die Erzählung „Die Verwandlung“ des deutschsprachigen Schriftstellers Franz Kafka ist mit ihrem Umfang von rund 70 Seiten (im vorliegenden Band: 77 Seiten) die längste seiner in sich abgeschlossenen und noch zu seinen Lebzeiten veröffentlichten. Erstveröffentlicht 1915, gilt sie heute als einer der großen literarischen Klassiker jener Epoche. Sie handelt vom Handelsreisenden Gregor Samsa, der eines Morgens aufwacht und feststellen muss, sich in ein schabenartiges Insekt verwandelt zu haben, woraufhin er seinen Dienst nicht mehr antreten kann und von seiner Familie in seinem Zimmer vor der Öffentlichkeit versteckt gehalten wird. In der Erzählung wird Samsas Existenz vornehmlich aus seiner subjektiven Sicht geschildert, ohne ihn jedoch als Erzähler einzusetzen. Flohmarkt-Fundstück für 2,- EUR: Das 114-seitige Softcover-Album des französischen Duos Gotlib (Text) und Alexis (Zeichnungen) erschien 1984 im Volksverlag. Nach sich absichtlich sehr ähnelnden Vorworten beider werden in der ersten Geschichte Ritterfilmklischees satirisch aufs Korn genommen. Danach geht der Filmbezug jedoch flöten und man widmet sich der Verballhornung diverser Literaturklassiker wie Hamlet, Taras Bulba, Die Kameliendame und Der Glöckner von Notre Dame, findet zwischendurch für „Mit Schirm, Charme und Melone“ zumindest zum Fernsehen zurück und hat sich mit „Die Tragödie der Sophie“ anscheinend selbst eine altertümlich anmutende Erzählung ausgedacht, die zu den Höhepunkten des Bands zählt. Das ist alles kurzweilig und relativ lustig zu lesen, bisweilen etwas schlüpfrig und wer in der Schule nicht mit dem Großteil hier aufgegriffenen Stoffs konfrontiert wurde, bekommt durch die Lektüre vielleicht sogar etwas Allgemeinbildung mit. Kurios: Wie ich zu meiner Überraschung feststellen durfte, dienten Zeichnungen aus der Glöckner-Geschichte dem zweiten Böhse-Onkelz-Album „Böse Menschen, böse Lieder“ sowie der Promotion des ’87er-Albums „Onkelz wie wir…“ und dessen T-Shirt-Motiv als Illustration.
Flohmarkt-Fundstück für 2,- EUR: Das 114-seitige Softcover-Album des französischen Duos Gotlib (Text) und Alexis (Zeichnungen) erschien 1984 im Volksverlag. Nach sich absichtlich sehr ähnelnden Vorworten beider werden in der ersten Geschichte Ritterfilmklischees satirisch aufs Korn genommen. Danach geht der Filmbezug jedoch flöten und man widmet sich der Verballhornung diverser Literaturklassiker wie Hamlet, Taras Bulba, Die Kameliendame und Der Glöckner von Notre Dame, findet zwischendurch für „Mit Schirm, Charme und Melone“ zumindest zum Fernsehen zurück und hat sich mit „Die Tragödie der Sophie“ anscheinend selbst eine altertümlich anmutende Erzählung ausgedacht, die zu den Höhepunkten des Bands zählt. Das ist alles kurzweilig und relativ lustig zu lesen, bisweilen etwas schlüpfrig und wer in der Schule nicht mit dem Großteil hier aufgegriffenen Stoffs konfrontiert wurde, bekommt durch die Lektüre vielleicht sogar etwas Allgemeinbildung mit. Kurios: Wie ich zu meiner Überraschung feststellen durfte, dienten Zeichnungen aus der Glöckner-Geschichte dem zweiten Böhse-Onkelz-Album „Böse Menschen, böse Lieder“ sowie der Promotion des ’87er-Albums „Onkelz wie wir…“ und dessen T-Shirt-Motiv als Illustration.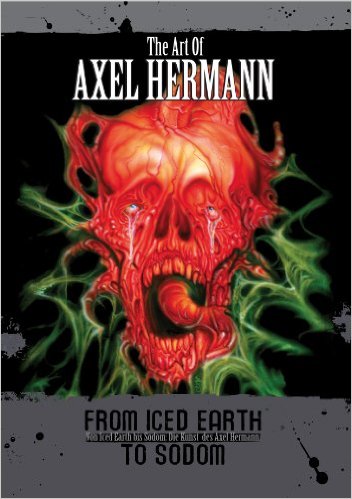 Einen nicht ungefähren Teil der Faszination des Metal-Genres machen zweifelsohne die Plattencover aus, die häufig große Kunst in Form morbider Visionen, dämonischer Fratzen, blasphemischer Illustrationen, fantasiereicher bunter Welten oder auch detailreicher Comiczeichnungen bieten. Mit seinem 2013 veröffentlichten großformatigen, ca. 160 Seiten starken Hochglanz-Bildband bietet der Iron-Pages-Verlag einem der anerkanntesten deutschen Künstler auf diesem Gebiet, dem Dortmunder Axel Hermann, ein Podium, um seine interessantesten Arbeiten in Buchform zusammenzufassen, zu präsentieren und zu kommentieren und vereint außerdem viele Stimmen von Szene-Angehörigen, für die er gearbeitet hat. Nach einem Vorwort Götz Kühnemunds und Robert Kampfs und ein paar persönlichen Zeilen Axel Hermanns nimmt letzterer den Leser des komplett zweisprachigen Buchs (alle Texte sind auf deutsch und englisch abgedruckt) mit auf eine spannende und inspirierende Reise durch sein Gesamtwerk, beginnend bei allerersten, köstlichen Zeichenversuchen eines typischen Metal-Fans über erste Auftragsarbeiten für „Century Media Records“-Veröffentlichungen, durch die man anhand des großartigen Covers für MORGOTH’ „Resurrection Absurd“ schnell beim Death Metal landet, einem seiner Hauptbetätigungsfelder. Weiter geht es mit den US-Metallern von ICED EARTH, deren Stammzeichner er geworden ist, über T-Shirt-Designs, Skizzen und Karikaturen bis hin zu jungen Arbeiten aus dem aktuellen Jahrzehnt. So bekommt man häufig einen Einblick in die Entstehungsprozesse weltberühmt gewordener Motive und erfährt interessante Details. Abgerundet wird das Buch durch Schnappschüsse aus Axels privatem Fotoarchiv und Humor sowie etwas Selbstironie kommen auch nicht zu kurz. Ein wertiger Schmöker nicht nur für Metal-Fans, den sich Axel Hermann redlich verdient hat und den durchzublättern nicht nur einen schönen Überblick über sein Schaffen bietet, sondern auch dazu einlädt, die eine oder andere Platte aufzulegen und/oder sich in den vereinnahmenden Bildern zu verlieren.
Einen nicht ungefähren Teil der Faszination des Metal-Genres machen zweifelsohne die Plattencover aus, die häufig große Kunst in Form morbider Visionen, dämonischer Fratzen, blasphemischer Illustrationen, fantasiereicher bunter Welten oder auch detailreicher Comiczeichnungen bieten. Mit seinem 2013 veröffentlichten großformatigen, ca. 160 Seiten starken Hochglanz-Bildband bietet der Iron-Pages-Verlag einem der anerkanntesten deutschen Künstler auf diesem Gebiet, dem Dortmunder Axel Hermann, ein Podium, um seine interessantesten Arbeiten in Buchform zusammenzufassen, zu präsentieren und zu kommentieren und vereint außerdem viele Stimmen von Szene-Angehörigen, für die er gearbeitet hat. Nach einem Vorwort Götz Kühnemunds und Robert Kampfs und ein paar persönlichen Zeilen Axel Hermanns nimmt letzterer den Leser des komplett zweisprachigen Buchs (alle Texte sind auf deutsch und englisch abgedruckt) mit auf eine spannende und inspirierende Reise durch sein Gesamtwerk, beginnend bei allerersten, köstlichen Zeichenversuchen eines typischen Metal-Fans über erste Auftragsarbeiten für „Century Media Records“-Veröffentlichungen, durch die man anhand des großartigen Covers für MORGOTH’ „Resurrection Absurd“ schnell beim Death Metal landet, einem seiner Hauptbetätigungsfelder. Weiter geht es mit den US-Metallern von ICED EARTH, deren Stammzeichner er geworden ist, über T-Shirt-Designs, Skizzen und Karikaturen bis hin zu jungen Arbeiten aus dem aktuellen Jahrzehnt. So bekommt man häufig einen Einblick in die Entstehungsprozesse weltberühmt gewordener Motive und erfährt interessante Details. Abgerundet wird das Buch durch Schnappschüsse aus Axels privatem Fotoarchiv und Humor sowie etwas Selbstironie kommen auch nicht zu kurz. Ein wertiger Schmöker nicht nur für Metal-Fans, den sich Axel Hermann redlich verdient hat und den durchzublättern nicht nur einen schönen Überblick über sein Schaffen bietet, sondern auch dazu einlädt, die eine oder andere Platte aufzulegen und/oder sich in den vereinnahmenden Bildern zu verlieren. Auf „Wo soll das alles enden“ folgte das mir noch unbekannte „Freakadellen und Bulletten“, bevor der Wahl-Berliner Cartoonist Gerhard Seyfried im Jahre 1980 für seinen rund 90-seitigen Farbcomic „Invasion aus dem Alltag“ zum Rotbuch-Verlag zurückkehrte. Zur wortspielreichen Deutschland-Karte des Debüts gesellt sich hier eine ebensolche (T)Europa-Topographie, bevor Seyfried erklärt, der Comic spiele „in der Linken“ und auf den folgenden Seiten einige derer Vertreter vorstellt, wofür er karikierend mit Klischees spielt. Fortan dreht es sich um eine fünfköpfige Clique, die im knollennasigen und detailreichen Funny-Stil gern mal mit den Gesetzeshütern in Konflikt gerät, welche hier eindeutig negativ und satirisch überzeichnet dargestellt werden und es natürlich darauf hinausläuft, dass diese den Kürzeren ziehen. Nach einigen doppelseitigen Zukunftsvisionen beginnt knapp nach der Hälfte jedoch das eigentliche Herzstück des Comics: In der Wohngemeinschaft versammelt sich die Clique zum gemeinsamen Kiffen und Fernsehen, als der Sprecher der „Abendschau“ verkündet, dass über dem Schöneberger Rathaus ein Ufo verharre. Am nächsten Morgen macht man sich auf den Weg und findet das Rathaus verlassen vor, während die Außerirdischen Berlin für die Hauptstadt des ganzen Planeten und unsere Anarcho-Freunde für seine offiziellen Repräsentanten halten. Das Missverständnis wird jedoch schnell ausgeräumt und man freundet sich locker miteinander an, doch die tatsächlichen Regierungsvertreter schicken Soldaten – zum Zorn der freundlichen, kugelförmigen Außerirdischen. Sie reagieren auf die irdische Provokation, indem sie den Anarchos eine Bombe bzw. „die entsetzlichste Waffe des Universums“ schenkt und sie zur neuen Regierung adelt. Die Soldaten und die Polizei nehmen daraufhin panisch Reißaus, doch aus Versehen geht die Bombe hoch und verwandelt die Erdenbewohner in „absolut unregierbare“ Individuen, was Seyfried erneut Anlass bietet, seine autoritätsfeindlichen freiheitsliebenden Ideale zum Ausdruck zu bringen. Im Zusammenspiel mit den bunten, klaren Zeichnungen und dem immer wieder bei aller trotzigen Naivität und Plakativität auch durchaus feinsinnigen Humor, der nebenbei Science-Fiction-Motive aufgreift und persifliert, ergibt sich ein kurzweiliges Vergnügen, das auf eine gewitzte Pointe zusteuert – und trotz viel Zeitkolorit angesichts der politischen Situation Deutschlands bzw. der Welt natürlich auf seine Weise zeitlos ist.
Auf „Wo soll das alles enden“ folgte das mir noch unbekannte „Freakadellen und Bulletten“, bevor der Wahl-Berliner Cartoonist Gerhard Seyfried im Jahre 1980 für seinen rund 90-seitigen Farbcomic „Invasion aus dem Alltag“ zum Rotbuch-Verlag zurückkehrte. Zur wortspielreichen Deutschland-Karte des Debüts gesellt sich hier eine ebensolche (T)Europa-Topographie, bevor Seyfried erklärt, der Comic spiele „in der Linken“ und auf den folgenden Seiten einige derer Vertreter vorstellt, wofür er karikierend mit Klischees spielt. Fortan dreht es sich um eine fünfköpfige Clique, die im knollennasigen und detailreichen Funny-Stil gern mal mit den Gesetzeshütern in Konflikt gerät, welche hier eindeutig negativ und satirisch überzeichnet dargestellt werden und es natürlich darauf hinausläuft, dass diese den Kürzeren ziehen. Nach einigen doppelseitigen Zukunftsvisionen beginnt knapp nach der Hälfte jedoch das eigentliche Herzstück des Comics: In der Wohngemeinschaft versammelt sich die Clique zum gemeinsamen Kiffen und Fernsehen, als der Sprecher der „Abendschau“ verkündet, dass über dem Schöneberger Rathaus ein Ufo verharre. Am nächsten Morgen macht man sich auf den Weg und findet das Rathaus verlassen vor, während die Außerirdischen Berlin für die Hauptstadt des ganzen Planeten und unsere Anarcho-Freunde für seine offiziellen Repräsentanten halten. Das Missverständnis wird jedoch schnell ausgeräumt und man freundet sich locker miteinander an, doch die tatsächlichen Regierungsvertreter schicken Soldaten – zum Zorn der freundlichen, kugelförmigen Außerirdischen. Sie reagieren auf die irdische Provokation, indem sie den Anarchos eine Bombe bzw. „die entsetzlichste Waffe des Universums“ schenkt und sie zur neuen Regierung adelt. Die Soldaten und die Polizei nehmen daraufhin panisch Reißaus, doch aus Versehen geht die Bombe hoch und verwandelt die Erdenbewohner in „absolut unregierbare“ Individuen, was Seyfried erneut Anlass bietet, seine autoritätsfeindlichen freiheitsliebenden Ideale zum Ausdruck zu bringen. Im Zusammenspiel mit den bunten, klaren Zeichnungen und dem immer wieder bei aller trotzigen Naivität und Plakativität auch durchaus feinsinnigen Humor, der nebenbei Science-Fiction-Motive aufgreift und persifliert, ergibt sich ein kurzweiliges Vergnügen, das auf eine gewitzte Pointe zusteuert – und trotz viel Zeitkolorit angesichts der politischen Situation Deutschlands bzw. der Welt natürlich auf seine Weise zeitlos ist. Der gebürtige Münchener und Wahl-Berliner Gerhard Seyfried avancierte im Laufe der Jahre zu einem der „linksradikalen“ Cartoonisten, dessen Zeichnungen weit über die Grenzen linker oder sonstiger Subkultur Bekanntheit erlangten. Sein erstes Buch erschien 1978 im Rotbuch-Verlag: „Wo soll das alles enden“, ein „kleiner Leitfaden durch die Geschichte der undogmatischen Linken“. Dieser besteht in erster Linie aus Zeichnungen, die zwischen 1972 bis 1978 im alternativen Münchner Stadtmagazin „Blatt“ erstveröffentlicht wurden. Vornehmlich in Einzel- und Wimmelbildern und mit vielen Wortspielen bis hin zu Kalauern zeichnet Seyfried karikierend die Entwicklung der außerparlamentarischen Opposition (APO) nach, über die Entstehung alternativer Buchläden, Magazine etc. bis hin zu alternativen Lebensentwürfen und der staatlichen Repression. All das ist angenehmerweise alles andere als frei von Selbstironie, wirkt aus heutiger Sicht aber bisweilen auch reichlich naiv und schwankt zwischen genial witzig und etwas infantil und platt. Damit ist Seyfried aber auch ein schönes Zeitdokument gelungen, das auf humoristische Weise einen Einblick in den damaligen Zeitgeist und das seinerzeitige Lebensgefühl und Selbstverständnis erlaubt, das auch heute noch auf seinen rund 100 Seiten für manch Lacher gut ist.
Der gebürtige Münchener und Wahl-Berliner Gerhard Seyfried avancierte im Laufe der Jahre zu einem der „linksradikalen“ Cartoonisten, dessen Zeichnungen weit über die Grenzen linker oder sonstiger Subkultur Bekanntheit erlangten. Sein erstes Buch erschien 1978 im Rotbuch-Verlag: „Wo soll das alles enden“, ein „kleiner Leitfaden durch die Geschichte der undogmatischen Linken“. Dieser besteht in erster Linie aus Zeichnungen, die zwischen 1972 bis 1978 im alternativen Münchner Stadtmagazin „Blatt“ erstveröffentlicht wurden. Vornehmlich in Einzel- und Wimmelbildern und mit vielen Wortspielen bis hin zu Kalauern zeichnet Seyfried karikierend die Entwicklung der außerparlamentarischen Opposition (APO) nach, über die Entstehung alternativer Buchläden, Magazine etc. bis hin zu alternativen Lebensentwürfen und der staatlichen Repression. All das ist angenehmerweise alles andere als frei von Selbstironie, wirkt aus heutiger Sicht aber bisweilen auch reichlich naiv und schwankt zwischen genial witzig und etwas infantil und platt. Damit ist Seyfried aber auch ein schönes Zeitdokument gelungen, das auf humoristische Weise einen Einblick in den damaligen Zeitgeist und das seinerzeitige Lebensgefühl und Selbstverständnis erlaubt, das auch heute noch auf seinen rund 100 Seiten für manch Lacher gut ist. Der Spiegel-Verlag brachte im Jahre 2006 dieses Sonderheft heraus, das sich auf 180 Seiten (abzgl. diverser Werbung) ausschließlich der spannenden Zeit des ersten deutschen Nachkriegsjahrzehnts widmet. Verschiedene Autoren widmeten sich verschiedenen Themenbereichen und ebenso unterschiedlich sind auch Informationsgehalt und Qualität zu bewerten. Klaus Wiegrefe steigt mit den Gründerjahren ein, gefolgt von einem Interview mit Altkanzler Helmut Schmidt. Reich bebildert sind viele Seiten, die einen Überblick über geschichtsträchtige Gebäude und Orte bieten. Viel wird auf die Rolle Konrad Adenauers eingegangen, wobei man für meinen Geschmack zu viele Seiten zu lang recht unkritisch bleibt. Kürzere Essays, z.B. über die versäumte Aufarbeitung von Kriegstraumata einer ganzen Generation, über jüdische Displaced Persons, Versuche der Aussöhnung mit Israel und deutsche US-Emigranten werden zwischengeschoben und reißen interessante Perspektiven an, die sicherlich eine tiefergehende Auseinandersetzung rechtfertigen würden. Großen Raum nehmen folgerichtig der schnell entfachte Kalte Krieg und die mit ihm einhergehenden Zugeständnisse an die Bevölkerung und alte Nazi-Schergen ein. Nachdenklich stimmt beispielsweise ein Artikel über den Krupp-Konzern und wie er sich aus seiner Verantwortung stehlen konnte. Deutsche Flüchtlinge und Vertriebene sind ebenso Thema wie die unfassbaren Attacken der katholischen Kirche gegen die evangelische und die theologischen Differenzen des Jahrzehnts, bei denen die Katholiken nicht gut wegkommen. Zur von verschiedenen Autoren beleuchteten Personalie Adenauer gesellt sich ein kritischer Blick auf den „Vater des Wirtschaftswunders“ Ludwig Erhard, dessen Mythos ein gutes Stück weit auseinandergenommen wird – denn so „sozial“ wie heutzutage insbesondere von SPD-„Genossen“ gern kolportiert, war seine Marktwirtschaft mitnichten. Daraus resultierend und überaus lesenswert ist Geschichtsprofessor Hans-Ulrich Wehlers Aufräumen mit dem wirtschaftlichen „Wachstumsfetischismus“, der immer wieder das „Wirtschaftswunder“ nostalgisch verklärt und dem Wunschtraum nachhängt, derartige Wirtschaftswachstumszahlen noch einmal erreichen zu können – gern auch als Argumentation im Klassenkampf von oben gegen die Unterschicht eingesetzt. Relativ ausführlich widmet man sich der größten Schande der deutschen Nachkriegsgeschichte, der versäumten Entnazifizierung – nicht ohne die „Sachzwänge“, die dazu ihren entscheidenden Teil beitrugen, gegenüberzustellen, ohne jedoch den damit einhergehenden Zynismus in vollem Umfang zu verdeutlichen und zu verurteilen. Vielleicht war das auch gar nicht nötig, denn es liest sich auch so beschämend genug. Die beschriebenen Schwierigkeiten für deutsche Kriegsheimkehrer, wieder in der Gesellschaft Fuß zu fassen, entbehren hingegen nicht einer gewissen Tragik. Wie ein Lichtblick erscheint da die breite Protestbewegung gegen Wiederbewaffnung und Westbindung, die das Spiegel special korrekt als Wendepunkt der politischen Kultur einordnet. Auf lediglich zwei Seiten tendenziell als eher abgefrühstückt hingegen empfinde ich Alexander Szandars Ausführungen zur von Adenauer flugs vorangetriebenen Wiederbewaffnung. Eher einseitig, dennoch in ihrem zusammenfassenden Charakter alles andere als uninteressant fallen unterdessen die Berichte über die Luftbrücke und ihre „Rosinenbomber“ aus. Und auch das Thema der deutsch-deutschen Spionage hätte auch in diesem begrenzten Rahmen wesentlich mehr Stoff als für nur eine Doppelseite geboten. Da verwundert es auch kaum, dass die komplexe und spannende Thematik der DDR nur in aller Kürze, am Rande und extrem einseitig abgehandelt wird – eines der größten Versäumnisse dieser Publikation.
Der Spiegel-Verlag brachte im Jahre 2006 dieses Sonderheft heraus, das sich auf 180 Seiten (abzgl. diverser Werbung) ausschließlich der spannenden Zeit des ersten deutschen Nachkriegsjahrzehnts widmet. Verschiedene Autoren widmeten sich verschiedenen Themenbereichen und ebenso unterschiedlich sind auch Informationsgehalt und Qualität zu bewerten. Klaus Wiegrefe steigt mit den Gründerjahren ein, gefolgt von einem Interview mit Altkanzler Helmut Schmidt. Reich bebildert sind viele Seiten, die einen Überblick über geschichtsträchtige Gebäude und Orte bieten. Viel wird auf die Rolle Konrad Adenauers eingegangen, wobei man für meinen Geschmack zu viele Seiten zu lang recht unkritisch bleibt. Kürzere Essays, z.B. über die versäumte Aufarbeitung von Kriegstraumata einer ganzen Generation, über jüdische Displaced Persons, Versuche der Aussöhnung mit Israel und deutsche US-Emigranten werden zwischengeschoben und reißen interessante Perspektiven an, die sicherlich eine tiefergehende Auseinandersetzung rechtfertigen würden. Großen Raum nehmen folgerichtig der schnell entfachte Kalte Krieg und die mit ihm einhergehenden Zugeständnisse an die Bevölkerung und alte Nazi-Schergen ein. Nachdenklich stimmt beispielsweise ein Artikel über den Krupp-Konzern und wie er sich aus seiner Verantwortung stehlen konnte. Deutsche Flüchtlinge und Vertriebene sind ebenso Thema wie die unfassbaren Attacken der katholischen Kirche gegen die evangelische und die theologischen Differenzen des Jahrzehnts, bei denen die Katholiken nicht gut wegkommen. Zur von verschiedenen Autoren beleuchteten Personalie Adenauer gesellt sich ein kritischer Blick auf den „Vater des Wirtschaftswunders“ Ludwig Erhard, dessen Mythos ein gutes Stück weit auseinandergenommen wird – denn so „sozial“ wie heutzutage insbesondere von SPD-„Genossen“ gern kolportiert, war seine Marktwirtschaft mitnichten. Daraus resultierend und überaus lesenswert ist Geschichtsprofessor Hans-Ulrich Wehlers Aufräumen mit dem wirtschaftlichen „Wachstumsfetischismus“, der immer wieder das „Wirtschaftswunder“ nostalgisch verklärt und dem Wunschtraum nachhängt, derartige Wirtschaftswachstumszahlen noch einmal erreichen zu können – gern auch als Argumentation im Klassenkampf von oben gegen die Unterschicht eingesetzt. Relativ ausführlich widmet man sich der größten Schande der deutschen Nachkriegsgeschichte, der versäumten Entnazifizierung – nicht ohne die „Sachzwänge“, die dazu ihren entscheidenden Teil beitrugen, gegenüberzustellen, ohne jedoch den damit einhergehenden Zynismus in vollem Umfang zu verdeutlichen und zu verurteilen. Vielleicht war das auch gar nicht nötig, denn es liest sich auch so beschämend genug. Die beschriebenen Schwierigkeiten für deutsche Kriegsheimkehrer, wieder in der Gesellschaft Fuß zu fassen, entbehren hingegen nicht einer gewissen Tragik. Wie ein Lichtblick erscheint da die breite Protestbewegung gegen Wiederbewaffnung und Westbindung, die das Spiegel special korrekt als Wendepunkt der politischen Kultur einordnet. Auf lediglich zwei Seiten tendenziell als eher abgefrühstückt hingegen empfinde ich Alexander Szandars Ausführungen zur von Adenauer flugs vorangetriebenen Wiederbewaffnung. Eher einseitig, dennoch in ihrem zusammenfassenden Charakter alles andere als uninteressant fallen unterdessen die Berichte über die Luftbrücke und ihre „Rosinenbomber“ aus. Und auch das Thema der deutsch-deutschen Spionage hätte auch in diesem begrenzten Rahmen wesentlich mehr Stoff als für nur eine Doppelseite geboten. Da verwundert es auch kaum, dass die komplexe und spannende Thematik der DDR nur in aller Kürze, am Rande und extrem einseitig abgehandelt wird – eines der größten Versäumnisse dieser Publikation. Dr. phil. Frank Schäfer ist nicht nur Musikjournalist und Autor sich immer wieder gern anekdotenhaft mit Hardrock und Heavy Metal auseinandersetzender Werke, sondern auch ein hervorragender Beobachter mit Sinn für Details, der in immer irgendwie autobiographisch wirkenden Geschichten und Geschichtchen den vermeintlich unbedeutenden Kleinigkeiten ebensoviel Platz einzuräumen scheint wie dem Spektakuläreren. Die 2003 im Oktober-Verlag veröffentlichte, rund 170-seitige und in neun Kapitel bzw. Abschnitte unterteilte Sammlung von Beziehungskisten und Alltagsbeobachtungen, von melancholischen Erinnerungen und auch mal witziger Situationskomik, der er den Titel „Verdreht“ vergab, erzählt vornehmlich von einer Jugendparty mit einem Schwerverletzten und später von einem Klassentreffen gealterter Männer und Frauen, dazwischen kürzere, autarke Erinnerungen. Der besondere Kniff ist, dass Schäfer die Haupthandlung um die Party, in der es um Andreas’ Interesse für Birgit geht, immer wieder zugunsten der in ihren Inhalten davon unabhängigen Anekdoten unterbricht, aber mehr als einmal zu ihr zurückkehrt, dabei auch gern nichtchronologisch die Geschichte weiter ausarbeitet. Neben den Empfindungen des Protagonisten in einer undurchsichtigen Gemengelage seines Freundeskreises, der sehr anschaulich skizziert und charakterisiert wird, bezieht sie ihre Spannung aus der Frage, wie genau es zu dem Unfall am Pool kam, der einen jungen Mann ins Krankenhaus brachte. Geht es gegen Ende des Buchs vornehmlich um ein Klassentreffen und das Wiederaufflammen einer alten Liebe, weicht die postpubertäre Stimmung jungmännischer Verunsicherung einer gereiften Melancholie angesichts gescheiterter Lebens- bzw. Beziehungsentwürfe, die Schäfer vor dem Abgleiten in die Desillusion rettet und stattdessen Hoffnung spendet, ohne die Bedeutung jahrzehntealter Kontakte, Freundschaften und Bindungen zu relativieren. Schäfers gern eingestreute pop- und subkulturelle Verweise (Dokkens „Breaking The Chains“ anyone?!) dürfen natürlich genauso wenig fehlen wie seine Vorliebe für obskure Fremdwörter, die er glücklicherweise so gut in den Griff bekommen hat, dass ihr sporadisches Durchscheinen wie ein individuelles Stilelement wirkt, das nicht stört. „Verdreht“ liest sich schnell und gut durch, wird auch durch das Lokalkolorit niedersächsischer Provinz authentisch verortet und geerdet und verleugnet seinen vermutlich ehrlichen, bodenständigen Anspruch nie zugunsten wenig nachvollziehbarer oder erzwungen wirkender Entwicklungen zwecks fragwürdiger Aufmerksamkeitsbuhlerei – konsequenterweise bekommt somit auch nicht alles einen positiven Ausgang. Etwas schade finde ich lediglich, dass er mit „Kirschblüte“ eine Geschichte erneut abdrucken ließ, die bereits aus dem nur ein Jahr zuvor veröffentlichten „Ich bin dann mal weg – Streifzüge durch die Pop-Kultur“ bekannt war.
Dr. phil. Frank Schäfer ist nicht nur Musikjournalist und Autor sich immer wieder gern anekdotenhaft mit Hardrock und Heavy Metal auseinandersetzender Werke, sondern auch ein hervorragender Beobachter mit Sinn für Details, der in immer irgendwie autobiographisch wirkenden Geschichten und Geschichtchen den vermeintlich unbedeutenden Kleinigkeiten ebensoviel Platz einzuräumen scheint wie dem Spektakuläreren. Die 2003 im Oktober-Verlag veröffentlichte, rund 170-seitige und in neun Kapitel bzw. Abschnitte unterteilte Sammlung von Beziehungskisten und Alltagsbeobachtungen, von melancholischen Erinnerungen und auch mal witziger Situationskomik, der er den Titel „Verdreht“ vergab, erzählt vornehmlich von einer Jugendparty mit einem Schwerverletzten und später von einem Klassentreffen gealterter Männer und Frauen, dazwischen kürzere, autarke Erinnerungen. Der besondere Kniff ist, dass Schäfer die Haupthandlung um die Party, in der es um Andreas’ Interesse für Birgit geht, immer wieder zugunsten der in ihren Inhalten davon unabhängigen Anekdoten unterbricht, aber mehr als einmal zu ihr zurückkehrt, dabei auch gern nichtchronologisch die Geschichte weiter ausarbeitet. Neben den Empfindungen des Protagonisten in einer undurchsichtigen Gemengelage seines Freundeskreises, der sehr anschaulich skizziert und charakterisiert wird, bezieht sie ihre Spannung aus der Frage, wie genau es zu dem Unfall am Pool kam, der einen jungen Mann ins Krankenhaus brachte. Geht es gegen Ende des Buchs vornehmlich um ein Klassentreffen und das Wiederaufflammen einer alten Liebe, weicht die postpubertäre Stimmung jungmännischer Verunsicherung einer gereiften Melancholie angesichts gescheiterter Lebens- bzw. Beziehungsentwürfe, die Schäfer vor dem Abgleiten in die Desillusion rettet und stattdessen Hoffnung spendet, ohne die Bedeutung jahrzehntealter Kontakte, Freundschaften und Bindungen zu relativieren. Schäfers gern eingestreute pop- und subkulturelle Verweise (Dokkens „Breaking The Chains“ anyone?!) dürfen natürlich genauso wenig fehlen wie seine Vorliebe für obskure Fremdwörter, die er glücklicherweise so gut in den Griff bekommen hat, dass ihr sporadisches Durchscheinen wie ein individuelles Stilelement wirkt, das nicht stört. „Verdreht“ liest sich schnell und gut durch, wird auch durch das Lokalkolorit niedersächsischer Provinz authentisch verortet und geerdet und verleugnet seinen vermutlich ehrlichen, bodenständigen Anspruch nie zugunsten wenig nachvollziehbarer oder erzwungen wirkender Entwicklungen zwecks fragwürdiger Aufmerksamkeitsbuhlerei – konsequenterweise bekommt somit auch nicht alles einen positiven Ausgang. Etwas schade finde ich lediglich, dass er mit „Kirschblüte“ eine Geschichte erneut abdrucken ließ, die bereits aus dem nur ein Jahr zuvor veröffentlichten „Ich bin dann mal weg – Streifzüge durch die Pop-Kultur“ bekannt war.