 Die sog. „Silver Surfer“, sprich: das Internet erkundende Rentner, sind für manch Spott gut, so auch in Christian Humbergs spürbar fiktiver, 320 Seiten starker Abhandlung über seinen sturen, rechthaberischen und in Sachen Computern vollkommen unbeleckten Vater Horst, dem von Humberg vorgeführten Paradebeispiel eines DAUs. Unterteilt in 18 Kapitel, Epilog und Anhang verwendet Humberg viel Zeit für eine ausführliche Charakterisierung Horsts, die Rückschlüsse dahingehend erlaubt, welcher Menschenschlag derartige DAUs wohl sein mögen, wie ihre Persönlichkeitsstruktur beschaffen sein muss, um sich so furchtbar nassforsch und uneinsichtig unbekanntem Terrain zu widmen.
Die sog. „Silver Surfer“, sprich: das Internet erkundende Rentner, sind für manch Spott gut, so auch in Christian Humbergs spürbar fiktiver, 320 Seiten starker Abhandlung über seinen sturen, rechthaberischen und in Sachen Computern vollkommen unbeleckten Vater Horst, dem von Humberg vorgeführten Paradebeispiel eines DAUs. Unterteilt in 18 Kapitel, Epilog und Anhang verwendet Humberg viel Zeit für eine ausführliche Charakterisierung Horsts, die Rückschlüsse dahingehend erlaubt, welcher Menschenschlag derartige DAUs wohl sein mögen, wie ihre Persönlichkeitsstruktur beschaffen sein muss, um sich so furchtbar nassforsch und uneinsichtig unbekanntem Terrain zu widmen.
Das geht mit viel Humor einher, ist häufig jedoch auch lediglich Aufhänger für recht gute Erklärungen des Autors in allgemeinverständlicher Sprache diverse Internet-Phänomene und -Themen betreffend, angefangen bei der Entwicklung des Netzes bis hin zu aktuellen Trends wie Twitter & Co. oder Phänomenen wie trashigen YouTube-Videos und deren Sternchen. Manches ist indes auch Quatsch: Ein Verkäufer bietet angeblich an, auf einem Mac jedes beliebige Betriebssystem zu installieren und im Internetkurs der Volkshochschule (den Horst immerhin besucht) wird plötzlich Excel unterrichtet? Horst fällt auf vorgeblich von seiner Sparkasse stammenden Spam herein und fängt sich ein Virus ein, das jedoch noch nicht einmal seine Kontodaten zu phishen versucht? Sein Kumpel Jupp wird zum Bürgermeister gewählt? Na gut, dessen „Hacking“ war vielmehr das Erschleichen eines vertraulichen Cloud-Passworts in der Verwaltung. Sehr richtig ist hingegen, dass man seine vermeintlichen Krankheiten keinesfalls googlen sollte und auch Humbergs nur am Rande mit seinem eigentlichen Thema zu tun habenden Definitionen verschiedener VHS-Besuchertypen werden vermutlich der Realität entspringen.
Dass Humberg von Bundesregierungen offenbar mehr hält als Horst, zeugt andererseits von einer nicht ungefähren Naivität, fast ähnlich der, mit der sich Horst dem Internet annähert. Dass Humberg generell eher ein Leisetreter denn tatsächlicher Rebell ist, beweisen auch seine immer wieder eingestreuten Erinnerungen an seine Studentenzeit, die mit bisweilen etwas anbiederndem Humor einhergehen und letztlich arg harmlos ausgefallen sind. In erster Linie dienen sie als längerer Abriss über die damalige Erstvernetzung seines Studentenwohnheims und gibt damit Einblicke in die Anfangszeit der flächendeckenden Verbreitung von Internetanschlüssen. Sie unterscheiden sich von den oftmals moritatischen, ihren Lerneffekt durch eine Art Moral erzielenden übrigen, in der Gegenwart verankerten Abhandlungen.
Aufgrund seines informativen Mehrwerts erscheint mir „Der alte Mann und das Netz“ recht gut für zur Selbstironie fähige ältere Semester geeignet, die nach der Lektüre selbst entscheiden könnten, ob sie die grundlegenden Dinge verstanden haben und es sich zutrauen, sich das Internet zunutze zu machen oder ob sie angesichts der beschriebenen Herausforderungen und Gefahren doch besser verzichten.
Der witzige Anhang, die „Hottipedia“ mit sehr eigenwilligen Begriffserklärungen, rundet das 2015 im Goldmann-Verlag erschienene Buch ab, das für meinen Geschmack gern noch frecher hätte ausfallen dürfen und auf seine irritierende, weil zu durchschaubare angebliche Authentizität besser ebenso verzichtet hätte wie auf manch halbgare Anekdote oder nicht zu Ende gedachte, an den Haaren herbeigezogene Konstruktion. Ein kurzweiliger Spaß ist es dank manch scharfer Beobachtung Humbergs und seiner komödiantischen Aufbereitung über weite Strecken jedoch allemal und verleiht evtl. auch manch DAU-Geschädigtem ein Gefühl der Genugtuung.

 Nach
Nach  Deutsche Sprache, schwere Sprache – um einmal einen Allgemeinplatz zu bemühen. Zu welchen Stilblüten und haarsträubenden Fehlern es kommt, wenn sich die Fallstricke des Schriftdeutschen mit Schludrigkeit und Ignoranz paaren, dokumentiert dieses rund 130 Seiten starke Buch aus dem ansonsten für seine Wörterbücher bekannten Langenscheidt-Verlag, das 2008 die Fortsetzung des Bands „Übelsetzungen: Sprachpannen aus aller Welt“ markierte. Mit Ortsangaben und meist den Namen der Einsender versehene Fotos von Hinweisschildern, Speisekarten etc. werden von Titus Arnu süffisant-humoristisch kommentiert. So wird aus einer Ferien- eine „Furienwohnung“, wird davor gewarnt, „mit dem wasserfahrzeug ins schiff zufahren“ oder Kaffee damit beworben, dass er mit „mittelmäßigem Braten“ vermischt worden sei. Gegliedert in verschiedene grobe Themengebiete sind diese zweiten „Übelsetzungen“ nicht nur ein kurzweiliger Spaß für linguistisch Interessierte oder schlicht Schadenfrohe, sondern vermitteln sie auch ein Gespür für die Herausforderungen an Übersetzungen angesichts sich schnell einschleichender, sinnentstellender Buchstabendreher oder -auslassungen sowie der Mehrdeutigkeit von Begriffen in der jeweils einen oder anderen Sprache. Da die meisten „Übelsetzungen“ aus touristischen Gebieten stammen und sich an Reisende wenden, ist dieses Büchlein auch eine ideale Urlaubslektüre – die abwischbare Oberfläche verzeiht Gepitscher am Strand oder Pool und der Inhalt schärft den Blick für kuriosen Sprachgebrauch am jeweiligen Urlaubsort.
Deutsche Sprache, schwere Sprache – um einmal einen Allgemeinplatz zu bemühen. Zu welchen Stilblüten und haarsträubenden Fehlern es kommt, wenn sich die Fallstricke des Schriftdeutschen mit Schludrigkeit und Ignoranz paaren, dokumentiert dieses rund 130 Seiten starke Buch aus dem ansonsten für seine Wörterbücher bekannten Langenscheidt-Verlag, das 2008 die Fortsetzung des Bands „Übelsetzungen: Sprachpannen aus aller Welt“ markierte. Mit Ortsangaben und meist den Namen der Einsender versehene Fotos von Hinweisschildern, Speisekarten etc. werden von Titus Arnu süffisant-humoristisch kommentiert. So wird aus einer Ferien- eine „Furienwohnung“, wird davor gewarnt, „mit dem wasserfahrzeug ins schiff zufahren“ oder Kaffee damit beworben, dass er mit „mittelmäßigem Braten“ vermischt worden sei. Gegliedert in verschiedene grobe Themengebiete sind diese zweiten „Übelsetzungen“ nicht nur ein kurzweiliger Spaß für linguistisch Interessierte oder schlicht Schadenfrohe, sondern vermitteln sie auch ein Gespür für die Herausforderungen an Übersetzungen angesichts sich schnell einschleichender, sinnentstellender Buchstabendreher oder -auslassungen sowie der Mehrdeutigkeit von Begriffen in der jeweils einen oder anderen Sprache. Da die meisten „Übelsetzungen“ aus touristischen Gebieten stammen und sich an Reisende wenden, ist dieses Büchlein auch eine ideale Urlaubslektüre – die abwischbare Oberfläche verzeiht Gepitscher am Strand oder Pool und der Inhalt schärft den Blick für kuriosen Sprachgebrauch am jeweiligen Urlaubsort. Wer hat sie als Kind nicht gern gelesen? Die Abenteuer der Ducks und ihrer Freunde, Bekannten und Gegner nicht nur in Entenhausen in Comicform. Duck’scher Chefzeichner für den Disney-Konzern war Mr. Carl Barks, deutsche Chef-Übersetzerin Frau Dr. Erika Fuchs, die den Dia- und Monologen sowie den Gedanken ihrer Schützlinge einen eigenen Stempel aufdrückte. Manch einen faszinierten die Entenhausener Überlieferungen auch über die Kindheit hinaus und ein paar Bildungsbürger unter ihnen wurden zu Donaldisten, um sich fortan wissenschaftlich mit Entenhausen auseinanderzusetzen. Einer von ihnen ist der ehemalige Feuilleton-Chef der FAZ, Patrick Bahners, der 2013 mit „Entenhausen: Die ganze Wahrheit“ im C.H.-Beck-Verlag seinen 208 Seiten starkes Debütband vorlegte, schick gebunden und mit integriertem Lesezeichen.
Wer hat sie als Kind nicht gern gelesen? Die Abenteuer der Ducks und ihrer Freunde, Bekannten und Gegner nicht nur in Entenhausen in Comicform. Duck’scher Chefzeichner für den Disney-Konzern war Mr. Carl Barks, deutsche Chef-Übersetzerin Frau Dr. Erika Fuchs, die den Dia- und Monologen sowie den Gedanken ihrer Schützlinge einen eigenen Stempel aufdrückte. Manch einen faszinierten die Entenhausener Überlieferungen auch über die Kindheit hinaus und ein paar Bildungsbürger unter ihnen wurden zu Donaldisten, um sich fortan wissenschaftlich mit Entenhausen auseinanderzusetzen. Einer von ihnen ist der ehemalige Feuilleton-Chef der FAZ, Patrick Bahners, der 2013 mit „Entenhausen: Die ganze Wahrheit“ im C.H.-Beck-Verlag seinen 208 Seiten starkes Debütband vorlegte, schick gebunden und mit integriertem Lesezeichen. Mit dem achten Mad-Taschenbuch erschien 1975 Stammzeichner Al Jaffees zweiter Auftritt in Buchform. Diesmal durfte er sich gänzlich seinen klugen Antworten auf dumme Fragen widmen, Jaffees Stammrubrik in den Mad-Magazinen. Nach einem schönen Vorwort und einer Widmung Jaffees an sich selbst ist das Buch in 14 Kapitel (hier „Abt.“ genannt) aufgeteilt, darunter die bekannten Doppelseiter in Comicform mit verschiedenen möglichen Antworten auf dumme Fragen sowie je einer Sprechblase zum Selbstausfüllen, mehrseitigen Comics, die natürlich ebenfalls die reinsten Spruchfeuerwerke sind und für den Sprücheklopfer böse enden, sowie weiteren Variationen wie schlagfertigen Reaktionen auf vermeintlich kluge Antworten und einem selbstironischen finalen Kapitel. Rund 160 Seiten stark und meines Erachtens mit das Beste, was Mad zu bieten hatte.
Mit dem achten Mad-Taschenbuch erschien 1975 Stammzeichner Al Jaffees zweiter Auftritt in Buchform. Diesmal durfte er sich gänzlich seinen klugen Antworten auf dumme Fragen widmen, Jaffees Stammrubrik in den Mad-Magazinen. Nach einem schönen Vorwort und einer Widmung Jaffees an sich selbst ist das Buch in 14 Kapitel (hier „Abt.“ genannt) aufgeteilt, darunter die bekannten Doppelseiter in Comicform mit verschiedenen möglichen Antworten auf dumme Fragen sowie je einer Sprechblase zum Selbstausfüllen, mehrseitigen Comics, die natürlich ebenfalls die reinsten Spruchfeuerwerke sind und für den Sprücheklopfer böse enden, sowie weiteren Variationen wie schlagfertigen Reaktionen auf vermeintlich kluge Antworten und einem selbstironischen finalen Kapitel. Rund 160 Seiten stark und meines Erachtens mit das Beste, was Mad zu bieten hatte. 1975 erschien mit der Nummer 7 das zweite Mad-Taschenbuch, das sich Sergio Aragones‘ in den Heften sonst nur als winzige Randzeichnungen zu findenden Comics widmet. Verlegt wurde es im Original jedoch offenbar bereits 1970 in den USA. Unterteilt in Kapitel wie „Sergio und die Kinder“, „Sergio am Strand“, Sergio und die Psychiater“, „Sergio und die Hunde“ usw. bekommt man themenbezogene, kurze Comics, die i.d.R. komplett ohne Sprech- oder Denkblasen auskommen, sich also auf die bildliche Darstellung beschränken. Der Zeichenstil ist Aragones-typisch karikierend und der Humor irgendwo zwischen naiv-nett bzw. harmlos bis augenzwinkernd frech oder leicht satirisch angesiedelt. In der Natur der Sache liegt es, dass sich ein solch quasi textfreies Taschenbuch natürlich sehr schnell durchblättert – für Kurzweil sorgt es allemal.
1975 erschien mit der Nummer 7 das zweite Mad-Taschenbuch, das sich Sergio Aragones‘ in den Heften sonst nur als winzige Randzeichnungen zu findenden Comics widmet. Verlegt wurde es im Original jedoch offenbar bereits 1970 in den USA. Unterteilt in Kapitel wie „Sergio und die Kinder“, „Sergio am Strand“, Sergio und die Psychiater“, „Sergio und die Hunde“ usw. bekommt man themenbezogene, kurze Comics, die i.d.R. komplett ohne Sprech- oder Denkblasen auskommen, sich also auf die bildliche Darstellung beschränken. Der Zeichenstil ist Aragones-typisch karikierend und der Humor irgendwo zwischen naiv-nett bzw. harmlos bis augenzwinkernd frech oder leicht satirisch angesiedelt. In der Natur der Sache liegt es, dass sich ein solch quasi textfreies Taschenbuch natürlich sehr schnell durchblättert – für Kurzweil sorgt es allemal. Dr. phil. Frank Schäfers 250 Seiten starke Essay- und Glossensammlung aus dem Jahre 2003 kann als Nachfolger zum ein Jahr ebenfalls im Verlag Schwarzkopf & Schwarzkopf vorausgegangenen
Dr. phil. Frank Schäfers 250 Seiten starke Essay- und Glossensammlung aus dem Jahre 2003 kann als Nachfolger zum ein Jahr ebenfalls im Verlag Schwarzkopf & Schwarzkopf vorausgegangenen 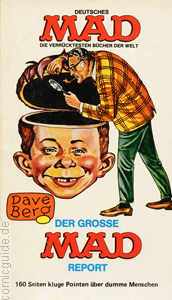 Nachdem Don Martin bereits zweimal im Taschenbuchformat seine satirischen Comics unters Volk bringen durfte, durfte 1974 mit der Nummer 6 endlich der New Yorker Dave Berg ran, der in der Heftreihe mit seinem „Reports“ in meist aus nur wenigen Panels bestehender, in sich abgeschlossener Comic-Strip-Form die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte und zum festen Bestandteil des Mad-Universums wurde. Mit viel, sich gerade im Nachhinein offenbarendem Zeitkolorit nimmt er Alltagsthemen aufs Korn; häufig sind typische Generationenkonflikte Ziel seiner pointiert aufbereiten Beobachtungen, in denen er es mit gewisser Vorliebe auf Spießer abgesehen hat, doch auch alle anderen bekommen ihr Fett weg. Widmen sich die Reporte in den Mad-Heften häufig einem bestimmten Thema, geht es in diesem der „Vernunft“ gewidmeten Buch themenübergreifend zu. Bergs halbrealistischer Zeichenstil ist sehr aufgeräumt und immer wieder taucht ein älterer Herr mit Hut und Pfeife auf, der ihm zum Verwechseln ähnlich sieht; er zeichnete sich gewissermaßen seine eigenen Cameos. Zwar ist die eine oder andere Pointe vorhersehbar und vom anarchischen, frechen Humor anderer Mad-Zeichner/-Redakteure ist Berg doch ein gutes Stück entfernt, dafür beherrscht er auch die leiseren Zwischentöne wie Selbstzweifel oder die Diskrepanz zwischen dem Inhalt seiner Gedankenblasen und dem letztlichen Handeln seiner Protagonisten – und es überwiegen die gelungenen Gags, die an eine selbst Mad-Lesern noch zugetraute Zurechnungsfähigkeit appellieren oder die Absurdität von Zeitgeisterscheinungen oder zwischenmenschlichen Verhaltensmustern hervorheben. Garniert wird das Ganze 160 Seiten lang vom erhöhten Gebrauch typischer Mad-Nachnamen wie Feinbein, Kaputtnik, Klotz und Weizenkeim, für die die deutsche Übersetzung verantwortlich zeichnet und damit ein Alleinstellungsmerkmal des bundesrepublikanischen Mad schuf.
Nachdem Don Martin bereits zweimal im Taschenbuchformat seine satirischen Comics unters Volk bringen durfte, durfte 1974 mit der Nummer 6 endlich der New Yorker Dave Berg ran, der in der Heftreihe mit seinem „Reports“ in meist aus nur wenigen Panels bestehender, in sich abgeschlossener Comic-Strip-Form die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte und zum festen Bestandteil des Mad-Universums wurde. Mit viel, sich gerade im Nachhinein offenbarendem Zeitkolorit nimmt er Alltagsthemen aufs Korn; häufig sind typische Generationenkonflikte Ziel seiner pointiert aufbereiten Beobachtungen, in denen er es mit gewisser Vorliebe auf Spießer abgesehen hat, doch auch alle anderen bekommen ihr Fett weg. Widmen sich die Reporte in den Mad-Heften häufig einem bestimmten Thema, geht es in diesem der „Vernunft“ gewidmeten Buch themenübergreifend zu. Bergs halbrealistischer Zeichenstil ist sehr aufgeräumt und immer wieder taucht ein älterer Herr mit Hut und Pfeife auf, der ihm zum Verwechseln ähnlich sieht; er zeichnete sich gewissermaßen seine eigenen Cameos. Zwar ist die eine oder andere Pointe vorhersehbar und vom anarchischen, frechen Humor anderer Mad-Zeichner/-Redakteure ist Berg doch ein gutes Stück entfernt, dafür beherrscht er auch die leiseren Zwischentöne wie Selbstzweifel oder die Diskrepanz zwischen dem Inhalt seiner Gedankenblasen und dem letztlichen Handeln seiner Protagonisten – und es überwiegen die gelungenen Gags, die an eine selbst Mad-Lesern noch zugetraute Zurechnungsfähigkeit appellieren oder die Absurdität von Zeitgeisterscheinungen oder zwischenmenschlichen Verhaltensmustern hervorheben. Garniert wird das Ganze 160 Seiten lang vom erhöhten Gebrauch typischer Mad-Nachnamen wie Feinbein, Kaputtnik, Klotz und Weizenkeim, für die die deutsche Übersetzung verantwortlich zeichnet und damit ein Alleinstellungsmerkmal des bundesrepublikanischen Mad schuf.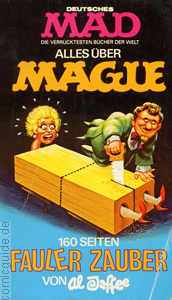 1973 erschien das erste Taschenbuch des deutschen Ablegers des Satire-Magazins „Mad“, nach Don Martin und Sergio Aragones durfte in der 1974 erschienenen Nummer 3 der heute dienstälteste Mad-Zeichner Al Jaffee ran und 160 Seiten zum Thema „Alles über Magie“ füllen. Ich nehme diese Dinger immer noch gerne mit, wenn ich sie auf Flohmärkten in die Finger kriege und dieses Exemplar zählt zu einem ganzen Stapel, den ich vor einiger Zeit günstigst abgreifen konnte. Das Buch setzt sich zusammen aus der Vorstellung von Zaubertricks und ihren absurden Erklärungen, Comics und den Jaffee-typisch herrlichen Antworten auf dumme Fragen, wie üblich stets mit einer freien Sprechblase zum Nachtragen einer eigenen Antwort (stets besonders schön, wenn der Vorbesitzer diese tatsächlich ausgefüllt hat). Kurzweilige und heutzutage nostalgische Unterhaltung voller Mad-Humor, wie er typischer kaum sein könnte.
1973 erschien das erste Taschenbuch des deutschen Ablegers des Satire-Magazins „Mad“, nach Don Martin und Sergio Aragones durfte in der 1974 erschienenen Nummer 3 der heute dienstälteste Mad-Zeichner Al Jaffee ran und 160 Seiten zum Thema „Alles über Magie“ füllen. Ich nehme diese Dinger immer noch gerne mit, wenn ich sie auf Flohmärkten in die Finger kriege und dieses Exemplar zählt zu einem ganzen Stapel, den ich vor einiger Zeit günstigst abgreifen konnte. Das Buch setzt sich zusammen aus der Vorstellung von Zaubertricks und ihren absurden Erklärungen, Comics und den Jaffee-typisch herrlichen Antworten auf dumme Fragen, wie üblich stets mit einer freien Sprechblase zum Nachtragen einer eigenen Antwort (stets besonders schön, wenn der Vorbesitzer diese tatsächlich ausgefüllt hat). Kurzweilige und heutzutage nostalgische Unterhaltung voller Mad-Humor, wie er typischer kaum sein könnte. Ex-„Stern“- und „Tempo“-Chefredakteur Michael Jürgs gelang 2009 mit dem in seiner Titelgebung auf Charlotte Roches „Feuchtgebiete“ referenzierenden „Seichtgebiete“ ein Bestseller, in dem er nach Gründen für rückläufige gesellschaftliche Bildung und zunehmende Verrohung sucht und diese in den Medien, vornehmlich im Angebot der Fernsehsender zu finden gehabt glaubt. Auf rund 250 Seiten (Taschenbuch-Ausgabe, Goldmann-Verlag) beschäftigt er sich mit dem Thema, doch bereits auf S. 17 stolpere ich über die arg verkürzte Mutmaßung, sog. „brutale Killerspiele“ könnten echte Killer „produzieren“, was mich auf unschöne Weise an moralinsaure und weltfremde Computer-/Videospiel-Debatten erinnert. Und während ich mich weiter durch sein Werk arbeite und dabei bisweilen mit seinem Schreibstil – häufig separiert er Neben- als Hauptsätze, um dann wieder arg verschachtelte oder bandwurmartige Absätze zu generieren – bisweilen auf Kriegsfuß stehe, neigt Jürgs zu langatmigen metapherreichen Schwurbeleien, statt auf den Punkt zu kommen. Das kann durchaus anstrengend werden, verklärt jedoch nicht den Blick auf den Inhalt, dem immer dann zugestimmt werden kann, wenn inhaltsarme, fragwürdige TV-Formate auf- und angegriffen werden und sich diese Kritik auch auf den Print-Bereich erstreckt.
Ex-„Stern“- und „Tempo“-Chefredakteur Michael Jürgs gelang 2009 mit dem in seiner Titelgebung auf Charlotte Roches „Feuchtgebiete“ referenzierenden „Seichtgebiete“ ein Bestseller, in dem er nach Gründen für rückläufige gesellschaftliche Bildung und zunehmende Verrohung sucht und diese in den Medien, vornehmlich im Angebot der Fernsehsender zu finden gehabt glaubt. Auf rund 250 Seiten (Taschenbuch-Ausgabe, Goldmann-Verlag) beschäftigt er sich mit dem Thema, doch bereits auf S. 17 stolpere ich über die arg verkürzte Mutmaßung, sog. „brutale Killerspiele“ könnten echte Killer „produzieren“, was mich auf unschöne Weise an moralinsaure und weltfremde Computer-/Videospiel-Debatten erinnert. Und während ich mich weiter durch sein Werk arbeite und dabei bisweilen mit seinem Schreibstil – häufig separiert er Neben- als Hauptsätze, um dann wieder arg verschachtelte oder bandwurmartige Absätze zu generieren – bisweilen auf Kriegsfuß stehe, neigt Jürgs zu langatmigen metapherreichen Schwurbeleien, statt auf den Punkt zu kommen. Das kann durchaus anstrengend werden, verklärt jedoch nicht den Blick auf den Inhalt, dem immer dann zugestimmt werden kann, wenn inhaltsarme, fragwürdige TV-Formate auf- und angegriffen werden und sich diese Kritik auch auf den Print-Bereich erstreckt.