 Die beliebte „Spion & Spion“-Reihe kam 1977 zum zweiten Mal in den deutschen Mad-Taschenbüchern zu Ehren. Auf (diesmal nummerierten) 160 Seiten wird sich wieder dialogfrei gegenseitig der Garaus gemacht, wobei die sich jeweils über ein paar Seiten erstreckenden Kurzgeschichten diesmal Titel bekommen haben: „Operation Volltreffer“, „Operation Rückschlag“ bis hin zu „Operation Operation“. Abgefahrene technische Kettenreaktionen scheinen mir diesmal bei den gegenseitigen Mordplänen eine noch größere Rolle zu spielen und wie üblich fällt meist derjenige selbst hinein, der dem anderen eine Grube gräbt – jedoch auch nicht immer, sodass der Ausgang nicht immer feststeht. Die Comics leben in erster Linie von ihrem Einfallsreichtum beim originellen Fallenbau, weniger von ihren Pointen. Wer der beiden namenlosen Spitzgesichter jeweils gewinnt, hält sich wie üblich die Waage. In ihrer komplett sinnbefreit anmutenden Reduzierung der Spionagetätigkeiten auf gegenseitiges Abmurksen ist „Spion & Spion“ ein amüsantes und zugleich makaber-satirisches Kind des Kalten Kriegs, das sich noch viele weitere Jahre behaupten sollte.
Die beliebte „Spion & Spion“-Reihe kam 1977 zum zweiten Mal in den deutschen Mad-Taschenbüchern zu Ehren. Auf (diesmal nummerierten) 160 Seiten wird sich wieder dialogfrei gegenseitig der Garaus gemacht, wobei die sich jeweils über ein paar Seiten erstreckenden Kurzgeschichten diesmal Titel bekommen haben: „Operation Volltreffer“, „Operation Rückschlag“ bis hin zu „Operation Operation“. Abgefahrene technische Kettenreaktionen scheinen mir diesmal bei den gegenseitigen Mordplänen eine noch größere Rolle zu spielen und wie üblich fällt meist derjenige selbst hinein, der dem anderen eine Grube gräbt – jedoch auch nicht immer, sodass der Ausgang nicht immer feststeht. Die Comics leben in erster Linie von ihrem Einfallsreichtum beim originellen Fallenbau, weniger von ihren Pointen. Wer der beiden namenlosen Spitzgesichter jeweils gewinnt, hält sich wie üblich die Waage. In ihrer komplett sinnbefreit anmutenden Reduzierung der Spionagetätigkeiten auf gegenseitiges Abmurksen ist „Spion & Spion“ ein amüsantes und zugleich makaber-satirisches Kind des Kalten Kriegs, das sich noch viele weitere Jahre behaupten sollte.

 Einen ungeschönten, wenig sentimentalen Blick auf das Leben (eines typischen Mad-Lesers) wirft das neunte Mad-Taschenbuch aus dem Jahre 1976, dessen Inhalt bereit s 1973 in den USA erstveröffentlicht wurde. Das rund 160 Seiten lange Konzept: Links eine großflächige Schwarzweiß-Zeichnung Woodbridges, meist eine Karikatur aus dem Alltag, rechts Larry Siegels (sehr gelungen übersetzter) Text in Strophenform, häufig mit „Schau“ im Imperativ eröffnend: „Schau, ein Baby!“, „Schau, wie du heulst!“, „Schau dich an!“ Auch Interjektionen und Inflektive treten gehäuft und meist wiederholend auf, bereits im Kaufanreiz auf der Büchrückseite: „Scheffel, scheffel, scheffel!“ Sprachlich wird also der kindgerechte Sprachstil herkömmlicher Fibeln persifliert, während es sich inhaltlich um eine absolut pessimistische, desillusorische Sicht auf Leben und Tod eines jugendlichen Versagers und erwachsenen Durchschnittsmanns handelt, der es zwar zu Job, Frau und Kindern im Laufe seiner Existenz bringt, zu dem das wirkliche Glück jedoch stets ausreichend Abstand hält. Neben der augenzwinkernden, ironischen, nicht selten auch auf z.B. Geschlechterklischees zurückgreifenden Betrachtung typischer Lebensstationen wie Kindheit, Jugend, Ehe und Alter schwingt stets Kritik an gesellschaftlichen Konventionen, die die freie Entfaltung des Individuums verhindern, mit, was „Die große Mad-Lebensfibel“ alles in allem zu einem makaber-vergnüglichen, auf den zweiten Blick jedoch durchaus auch etwas traurigen oder zumindest nachdenklich stimmenden, jedenfalls immer etwas hintersinnigen Angelegenheit macht.
Einen ungeschönten, wenig sentimentalen Blick auf das Leben (eines typischen Mad-Lesers) wirft das neunte Mad-Taschenbuch aus dem Jahre 1976, dessen Inhalt bereit s 1973 in den USA erstveröffentlicht wurde. Das rund 160 Seiten lange Konzept: Links eine großflächige Schwarzweiß-Zeichnung Woodbridges, meist eine Karikatur aus dem Alltag, rechts Larry Siegels (sehr gelungen übersetzter) Text in Strophenform, häufig mit „Schau“ im Imperativ eröffnend: „Schau, ein Baby!“, „Schau, wie du heulst!“, „Schau dich an!“ Auch Interjektionen und Inflektive treten gehäuft und meist wiederholend auf, bereits im Kaufanreiz auf der Büchrückseite: „Scheffel, scheffel, scheffel!“ Sprachlich wird also der kindgerechte Sprachstil herkömmlicher Fibeln persifliert, während es sich inhaltlich um eine absolut pessimistische, desillusorische Sicht auf Leben und Tod eines jugendlichen Versagers und erwachsenen Durchschnittsmanns handelt, der es zwar zu Job, Frau und Kindern im Laufe seiner Existenz bringt, zu dem das wirkliche Glück jedoch stets ausreichend Abstand hält. Neben der augenzwinkernden, ironischen, nicht selten auch auf z.B. Geschlechterklischees zurückgreifenden Betrachtung typischer Lebensstationen wie Kindheit, Jugend, Ehe und Alter schwingt stets Kritik an gesellschaftlichen Konventionen, die die freie Entfaltung des Individuums verhindern, mit, was „Die große Mad-Lebensfibel“ alles in allem zu einem makaber-vergnüglichen, auf den zweiten Blick jedoch durchaus auch etwas traurigen oder zumindest nachdenklich stimmenden, jedenfalls immer etwas hintersinnigen Angelegenheit macht. Seit 1961 erfreuen sich die „Spion & Spion“-Comics des Zeichners Antonio Prohias im US-amerikanischen Mad-Magazin großer Beliebtheit, fanden ebenso in den deutschen Mad-Heften Beachtung und debütierten im Taschenbuch-Format 1975: Mit dem fünften Mad-Taschenbuch kamen sie nach Don Martin, Sergio Aragones und Al Jafee zur Ehre, sich auf rund 160 (unnummerierten) Schwarzweiß-Seiten in kurzen Comic-Geschichten sowie großformatigen Einzelbildern gegenseitig an den Kragen gehen zu dürfen. Es handelt sich um zwei spitznasige Gestalten, deren Aussehen an Mensch-Vogel-Hybridwesen erinnert und die sich bis auf ihre weiße bzw. schwarze Kleidung ähneln wie ein Ei dem anderen. Sie versuchen stets, sich gegenseitig zu überlisten, sich geheime Informationen abzujagen oder schlicht, den jeweils anderen auszuschalten. Dabei geht es comichaft überzeichnet gewalttätig zu und derjenige, der dem anderen eine Falle stellt, fällt meist selbst hinein – aber nicht immer, wodurch der Ausgang häufig ungewiss bleibt. Wer jeweils gewinnt, ist sehr ausgewogen und weder Figurengestaltung noch Inhalte lassen Rückschlüsse auf ihre jeweiligen Auftraggeber, ihr politisches Lager oder den konkreten Gegenstand ihrer Spionagetätigkeiten zu. „Spion & Spion“ ist die Persiflage eines Teilbereichs des Kalten Kriegs, die das Schwarzweißdenken jener Ära aufs Korn nimmt, was sich in der Farbgestaltung widerspiegelt. Eine Besonderheit ist, dass die Comics komplett ohne Dialoge, innere Monologe oder erläuternde, einordnende Texte auskommen. Dadurch muss man mitunter schon genauer hinschauen, um die Handlung zu erfassen, was dem Ganzen auch etwas Pantomimisches verleiht, was wiederum ebenfalls zur Schwarzweißgestaltung passt. Mit dem Platz ging man recht großzügig um und platzierte lediglich ein bis zwei Panels pro Seite, sodass man mit diesem Band entsprechend schnell durch ist. „Spion & Spion“ gehören zu den Ikonen der Mad-Welt, sind fest im popkulturellen Gedächtnis verhaftet und wurden später u.a. die titelgebenden Helden von Computerspielen.
Seit 1961 erfreuen sich die „Spion & Spion“-Comics des Zeichners Antonio Prohias im US-amerikanischen Mad-Magazin großer Beliebtheit, fanden ebenso in den deutschen Mad-Heften Beachtung und debütierten im Taschenbuch-Format 1975: Mit dem fünften Mad-Taschenbuch kamen sie nach Don Martin, Sergio Aragones und Al Jafee zur Ehre, sich auf rund 160 (unnummerierten) Schwarzweiß-Seiten in kurzen Comic-Geschichten sowie großformatigen Einzelbildern gegenseitig an den Kragen gehen zu dürfen. Es handelt sich um zwei spitznasige Gestalten, deren Aussehen an Mensch-Vogel-Hybridwesen erinnert und die sich bis auf ihre weiße bzw. schwarze Kleidung ähneln wie ein Ei dem anderen. Sie versuchen stets, sich gegenseitig zu überlisten, sich geheime Informationen abzujagen oder schlicht, den jeweils anderen auszuschalten. Dabei geht es comichaft überzeichnet gewalttätig zu und derjenige, der dem anderen eine Falle stellt, fällt meist selbst hinein – aber nicht immer, wodurch der Ausgang häufig ungewiss bleibt. Wer jeweils gewinnt, ist sehr ausgewogen und weder Figurengestaltung noch Inhalte lassen Rückschlüsse auf ihre jeweiligen Auftraggeber, ihr politisches Lager oder den konkreten Gegenstand ihrer Spionagetätigkeiten zu. „Spion & Spion“ ist die Persiflage eines Teilbereichs des Kalten Kriegs, die das Schwarzweißdenken jener Ära aufs Korn nimmt, was sich in der Farbgestaltung widerspiegelt. Eine Besonderheit ist, dass die Comics komplett ohne Dialoge, innere Monologe oder erläuternde, einordnende Texte auskommen. Dadurch muss man mitunter schon genauer hinschauen, um die Handlung zu erfassen, was dem Ganzen auch etwas Pantomimisches verleiht, was wiederum ebenfalls zur Schwarzweißgestaltung passt. Mit dem Platz ging man recht großzügig um und platzierte lediglich ein bis zwei Panels pro Seite, sodass man mit diesem Band entsprechend schnell durch ist. „Spion & Spion“ gehören zu den Ikonen der Mad-Welt, sind fest im popkulturellen Gedächtnis verhaftet und wurden später u.a. die titelgebenden Helden von Computerspielen.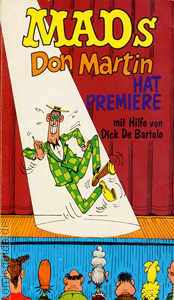 Endlich liegt mir nun auch das erste Mad-Taschenbuch vor, bei seinem Erscheinen 1973 noch „Mad Paperback“ genannt. Es war an Stammzeichner Don Martin, dem „Meister des bebilderten Slapsticks und des schwarzen Humors“ (Wikipedia), die 73-bändige Reihe mit seinem unverkennbaren Stil zu eröffnen. 160 Schwarzweiß-Seiten lang darf man sich an seinen Comics erfreuen, derer es neun Stück ins Buch geschafft haben. In „Der Stern von Brooklyn“ macht er sich über das Showgeschäft lustig, „An einem Frühlingstag“ nimmt technischen Fortschritt und Konsum anhand einer – bzw. vieler verschiedener – Armbanduhren aufs Korn, die drei „Rauch über der Prärie“-Teile sind Western-Persiflagen, „Nancy Nett, Stewardess“ ist eine gelungene Parodie auf die Sicherheitsinstruktionen durch Flugbegleiterinnen und mein persönlicher Höhepunkt des Buchs, „Schönheit kann man kaufen“ ist eine Karikatur auf weiblichen Schönheitswahn, „Ein stinknormaler Tag“ zeigt das Privatleben eines Hunds, wenn das Herrchen länger außer Haus ist und „Lance Parkertip“ ist eine jener beliebten Film-noir-Parodien – allesamt natürlich in Martins slapsticklastigem, heillos überzeichnetem, herrlich krudem Stil und mit meist gelungenen, unvorhergesehen Pointen veredelt. Ein bisschen war damals aber schon noch der Wurm drin: Die eine gewichtige Rolle in der ersten Geschichte spielende Spinne hat lediglich sechs Beine und damit eindeutig zwei zu wenig, Hollywood wird teilweise mit „ie“ geschrieben und die Zeichnungen wurden teils sehr unsauber entkoloriert. Bemerkenswertes Detail, das es irgendwie auch in die deutsche Ausgabe geschafft hat: Das eine Domina zierende Hakenkreuz.
Endlich liegt mir nun auch das erste Mad-Taschenbuch vor, bei seinem Erscheinen 1973 noch „Mad Paperback“ genannt. Es war an Stammzeichner Don Martin, dem „Meister des bebilderten Slapsticks und des schwarzen Humors“ (Wikipedia), die 73-bändige Reihe mit seinem unverkennbaren Stil zu eröffnen. 160 Schwarzweiß-Seiten lang darf man sich an seinen Comics erfreuen, derer es neun Stück ins Buch geschafft haben. In „Der Stern von Brooklyn“ macht er sich über das Showgeschäft lustig, „An einem Frühlingstag“ nimmt technischen Fortschritt und Konsum anhand einer – bzw. vieler verschiedener – Armbanduhren aufs Korn, die drei „Rauch über der Prärie“-Teile sind Western-Persiflagen, „Nancy Nett, Stewardess“ ist eine gelungene Parodie auf die Sicherheitsinstruktionen durch Flugbegleiterinnen und mein persönlicher Höhepunkt des Buchs, „Schönheit kann man kaufen“ ist eine Karikatur auf weiblichen Schönheitswahn, „Ein stinknormaler Tag“ zeigt das Privatleben eines Hunds, wenn das Herrchen länger außer Haus ist und „Lance Parkertip“ ist eine jener beliebten Film-noir-Parodien – allesamt natürlich in Martins slapsticklastigem, heillos überzeichnetem, herrlich krudem Stil und mit meist gelungenen, unvorhergesehen Pointen veredelt. Ein bisschen war damals aber schon noch der Wurm drin: Die eine gewichtige Rolle in der ersten Geschichte spielende Spinne hat lediglich sechs Beine und damit eindeutig zwei zu wenig, Hollywood wird teilweise mit „ie“ geschrieben und die Zeichnungen wurden teils sehr unsauber entkoloriert. Bemerkenswertes Detail, das es irgendwie auch in die deutsche Ausgabe geschafft hat: Das eine Domina zierende Hakenkreuz. 1976 in den USA, 1977 übersetzt in Deutschland erschienen, widmet sich das 14. Mad-Taschenbuch 160 Seiten lang und unterteilt in elf Kapitel beliebten Freizeitaktivitäten wie Wandern und Zelten, Segeln, Pflanzen und Blumen, Radfahren, Zeichnen und Malen, Schnorcheln, Basteln, Kegeln, Muskeltraining, Jagdsport sowie Sportfliegen, wovon typische Mad-Leser das Wenigste ernsthaft interessiert haben dürfte. Deshalb widmet sich de Bartolo in seinen Texten – in diesem Falle nicht in Comic-, sondern in Einführungs- und Anleitungsform – auch vielmehr der ironischen bis sarkastischen Verballhornung dieser Sportarten und teils abenteuerlichen Hobbys und derjenigen, die ihnen nachgehen. Pointe beinahe jeden gagreichen, mit Tücken und Klischees spielenden Kapitels ist, dass irgendwie doch alles zum Scheitern verurteilt ist. Trotz George Woodbridges witziger, großflächiger Illustrationen hat man allein den Lesestoff betreffend von diesem Büchlein länger etwas als von einem reinen Comicband, wenngleich es manchmal schwer fällt, sich auf den kleingedruckten Text zu konzentrieren, wenn darunter eine große karikierende Zeichnung um die Aufmerksamkeit buhlt. Viele echte Schmunzler sind dabei, manches wirkt heutzutage aber auch etwas abgegriffen oder überholt. Am größten ist der Lesespaß i.d.R. immer dann, wenn die jeweiligen Aktivitäten als Geldschneiderei der Freizeitindustrie oder als armselige Indizien einer Profilneurose entlarvt werden.
1976 in den USA, 1977 übersetzt in Deutschland erschienen, widmet sich das 14. Mad-Taschenbuch 160 Seiten lang und unterteilt in elf Kapitel beliebten Freizeitaktivitäten wie Wandern und Zelten, Segeln, Pflanzen und Blumen, Radfahren, Zeichnen und Malen, Schnorcheln, Basteln, Kegeln, Muskeltraining, Jagdsport sowie Sportfliegen, wovon typische Mad-Leser das Wenigste ernsthaft interessiert haben dürfte. Deshalb widmet sich de Bartolo in seinen Texten – in diesem Falle nicht in Comic-, sondern in Einführungs- und Anleitungsform – auch vielmehr der ironischen bis sarkastischen Verballhornung dieser Sportarten und teils abenteuerlichen Hobbys und derjenigen, die ihnen nachgehen. Pointe beinahe jeden gagreichen, mit Tücken und Klischees spielenden Kapitels ist, dass irgendwie doch alles zum Scheitern verurteilt ist. Trotz George Woodbridges witziger, großflächiger Illustrationen hat man allein den Lesestoff betreffend von diesem Büchlein länger etwas als von einem reinen Comicband, wenngleich es manchmal schwer fällt, sich auf den kleingedruckten Text zu konzentrieren, wenn darunter eine große karikierende Zeichnung um die Aufmerksamkeit buhlt. Viele echte Schmunzler sind dabei, manches wirkt heutzutage aber auch etwas abgegriffen oder überholt. Am größten ist der Lesespaß i.d.R. immer dann, wenn die jeweiligen Aktivitäten als Geldschneiderei der Freizeitindustrie oder als armselige Indizien einer Profilneurose entlarvt werden.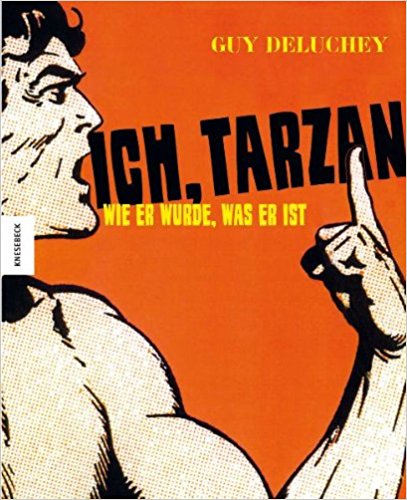 Tarzan, „Affenmensch“ und Bewohner des afrikanischen Urwalds, wurde 1912 vom Schriftsteller Edgar Rice Burroughs erfunden und somit Protagonist von rund 30 Abenteuerromanen. Der französische Journalist Guy Deluchey ist beinharter Fan dieser fiktiven Figur und Autor dieses rund 290-seitigen, 2010 in Frankreich und übersetzt 2011 im Knesebeck-Verlag erschienen Buchs, einer Mischung aus Bildband und Filmographie. Neben Burroughs’ Büchern existieren nämlich nicht weniger als 43 Tarzan-Verfilmungen und diverse TV-Serien mit insgesamt 21 verschiedenen Tarzan-Darstellern, darunter Namen wie Johnny Weissmuller, Lex Barker, Miles O’Keeffe und Christopher Lambert. Zwischen etlichen großformatigen, raren Set- und Aushangfotos, Filmplakaten etc. schlüpft Deluchey als besonderer erzählerischer Kniff in die Rolle Tarzans und lässt ihn im großzügig gesetzten Textteil all seine Verfilmungen in chronologischer Reihenfolge nicht nur beurteilen, sondern auch interessante Anekdoten und Details von den Dreharbeiten berichten. Das ist filmgeschichtlich auch für Nicht-Tarzan-Fans überaus interessant, zumal auch sämtliche Stummfilme abgehandelt werden und der Rezipient erfährt, inwiefern die Verfilmungen von den literarischen Vorlagen abweichen – teils nämlich beträchtlich. Interessanterweise sind insbesondere die Stummfilme wesentlich vorlagengetreuer als die späteren, viel populäreren Tonfilme. Dass sich Tarzan von Liane zu Liane schwingt war beispielsweise ebenso wenig Intention Burroughs’ wie sein jodelnder Schrei – und auch Tarzans Doppelleben als Herr des Urwalds auf der einen und zivilisierter Lebemann auf der anderen Seite wurde häufig unterschlagen. Zwischendurch wird in Exkursionen auf Tarzan-Comics, -Fernsehserien, -Zeichentrickfilme und -Fanartikel eingegangen. Das liest sich alles recht gut und liefert einen schönen Überblick über das Tarzan-Universum und seine Hintergründe unter Berücksichtigung des jeweiligen Zeitgeists. Auch optisch wie haptisch macht das großformatige Buch im Hardcover-Einband einiges her. Das matte Kartonpapier ist wertig und riecht gut und unabhängig vom Text macht es insbesondere für cineastisch Interessierte Spaß, durch all die Fotos und Illustrationen zu blättern. Die Krux ist jedoch, dass das Buch von außen inkl. Rückentext den Eindruck erweckt, die gesamte Geschichte Tarzans abzudecken, während der Inhalt sich eben vornehmlich den Verfilmungen widmet. Dies könnte für Frust beim ein oder anderen Käufer sorgen, denn „Wie er wurde, was er ist“ erläutert Deluchey nicht wirklich. Zudem hätte eine sorgfältigere Qualitätskontrolle sicherlich verpixelte Bilder sowie hier und da etwas ungelenkte Formulierungen getilgt. Mit meinem Faible für Filmgeschichte und meinen Erinnerungen an die alten Weissmuller-Filme aber konnte ich viel mit diesem schönen Werk anfangen.
Tarzan, „Affenmensch“ und Bewohner des afrikanischen Urwalds, wurde 1912 vom Schriftsteller Edgar Rice Burroughs erfunden und somit Protagonist von rund 30 Abenteuerromanen. Der französische Journalist Guy Deluchey ist beinharter Fan dieser fiktiven Figur und Autor dieses rund 290-seitigen, 2010 in Frankreich und übersetzt 2011 im Knesebeck-Verlag erschienen Buchs, einer Mischung aus Bildband und Filmographie. Neben Burroughs’ Büchern existieren nämlich nicht weniger als 43 Tarzan-Verfilmungen und diverse TV-Serien mit insgesamt 21 verschiedenen Tarzan-Darstellern, darunter Namen wie Johnny Weissmuller, Lex Barker, Miles O’Keeffe und Christopher Lambert. Zwischen etlichen großformatigen, raren Set- und Aushangfotos, Filmplakaten etc. schlüpft Deluchey als besonderer erzählerischer Kniff in die Rolle Tarzans und lässt ihn im großzügig gesetzten Textteil all seine Verfilmungen in chronologischer Reihenfolge nicht nur beurteilen, sondern auch interessante Anekdoten und Details von den Dreharbeiten berichten. Das ist filmgeschichtlich auch für Nicht-Tarzan-Fans überaus interessant, zumal auch sämtliche Stummfilme abgehandelt werden und der Rezipient erfährt, inwiefern die Verfilmungen von den literarischen Vorlagen abweichen – teils nämlich beträchtlich. Interessanterweise sind insbesondere die Stummfilme wesentlich vorlagengetreuer als die späteren, viel populäreren Tonfilme. Dass sich Tarzan von Liane zu Liane schwingt war beispielsweise ebenso wenig Intention Burroughs’ wie sein jodelnder Schrei – und auch Tarzans Doppelleben als Herr des Urwalds auf der einen und zivilisierter Lebemann auf der anderen Seite wurde häufig unterschlagen. Zwischendurch wird in Exkursionen auf Tarzan-Comics, -Fernsehserien, -Zeichentrickfilme und -Fanartikel eingegangen. Das liest sich alles recht gut und liefert einen schönen Überblick über das Tarzan-Universum und seine Hintergründe unter Berücksichtigung des jeweiligen Zeitgeists. Auch optisch wie haptisch macht das großformatige Buch im Hardcover-Einband einiges her. Das matte Kartonpapier ist wertig und riecht gut und unabhängig vom Text macht es insbesondere für cineastisch Interessierte Spaß, durch all die Fotos und Illustrationen zu blättern. Die Krux ist jedoch, dass das Buch von außen inkl. Rückentext den Eindruck erweckt, die gesamte Geschichte Tarzans abzudecken, während der Inhalt sich eben vornehmlich den Verfilmungen widmet. Dies könnte für Frust beim ein oder anderen Käufer sorgen, denn „Wie er wurde, was er ist“ erläutert Deluchey nicht wirklich. Zudem hätte eine sorgfältigere Qualitätskontrolle sicherlich verpixelte Bilder sowie hier und da etwas ungelenkte Formulierungen getilgt. Mit meinem Faible für Filmgeschichte und meinen Erinnerungen an die alten Weissmuller-Filme aber konnte ich viel mit diesem schönen Werk anfangen. Mad-Taschenbuch-Premiere für das Texter/Zeichner-Duo Hart und Coker Jr. im 1976 erschienenen zwölften Band der Reihe, der leider ein wenig Etikettenschwindel betreibt: Zwar beginnt er in Comicform mit der amüsanten Gegenüberstellung nerviger menschengemachter Alltagssituationen und der Möglichkeit, auf diese nicht nur adäquat, sondern derart zu reagieren, dass man es hübsch zurückzahlt – gestreckt wird dieses Konzept jedoch durch weniger lustige „Du weißt, dass dir eine qualvolle Zeit bevorsteht, wenn…“-Panels und anhand sämtlicher Sternzeichen durchexerzierter, jedoch offenbar völlig willkürlicher und weitestgehend verzichtbarer Horoskop-Parodien in Form des „astrologischen Qual-Kalenders“. „Die Mad-Fibeln der süßen Rache“ greifen das Konzept in Gedichtform wieder erfreulich lustig auf, während „Die Ehrengalerie unbekannter Quäler“ sich einmal mehr menschgemachten Alltagsqualen widmet und „Qual per Post“ auf unliebsame Briefe eingeht. Das ist der typische, mal mehr, mal weniger pointenstarke Mad-Humor, wie man ihn mag, mir jedoch letztlich etwas zu viel Füllmaterial und im Endeffekt hätte man besser daran getan, den Band „Das Mad-Buch der Qual“ zu nennen. Für diese Ausgabe kehrte man im Übrigen zur alten Seitenstärke (160 Seiten) zurück.
Mad-Taschenbuch-Premiere für das Texter/Zeichner-Duo Hart und Coker Jr. im 1976 erschienenen zwölften Band der Reihe, der leider ein wenig Etikettenschwindel betreibt: Zwar beginnt er in Comicform mit der amüsanten Gegenüberstellung nerviger menschengemachter Alltagssituationen und der Möglichkeit, auf diese nicht nur adäquat, sondern derart zu reagieren, dass man es hübsch zurückzahlt – gestreckt wird dieses Konzept jedoch durch weniger lustige „Du weißt, dass dir eine qualvolle Zeit bevorsteht, wenn…“-Panels und anhand sämtlicher Sternzeichen durchexerzierter, jedoch offenbar völlig willkürlicher und weitestgehend verzichtbarer Horoskop-Parodien in Form des „astrologischen Qual-Kalenders“. „Die Mad-Fibeln der süßen Rache“ greifen das Konzept in Gedichtform wieder erfreulich lustig auf, während „Die Ehrengalerie unbekannter Quäler“ sich einmal mehr menschgemachten Alltagsqualen widmet und „Qual per Post“ auf unliebsame Briefe eingeht. Das ist der typische, mal mehr, mal weniger pointenstarke Mad-Humor, wie man ihn mag, mir jedoch letztlich etwas zu viel Füllmaterial und im Endeffekt hätte man besser daran getan, den Band „Das Mad-Buch der Qual“ zu nennen. Für diese Ausgabe kehrte man im Übrigen zur alten Seitenstärke (160 Seiten) zurück. Der 15. Band der frankobelgischen Comic-Reihe „Asterix“ um das renitent wehrhafte gallische Dorf, das sich mithilfe eines Zaubertranks gegen die römischen Invasoren zur Wehr setzt, erschien erstmals 1970 und in der bekannten 48-seitigen Albenform in Deutschland 1973. Die Römer engagieren Destructivus, um Zwietracht bei den Galliern zu sähen und diese dadurch zu spalten, um sie – derart geschwächt – leichter bekämpfen und schließlich ihr Dorf einnehmen können. „Streit um Asterix“ bietet damit einen schönen humoristischen Exkurs in psychologische Kriegsführung (was auch Anlass für einen gelungenen Running Gag ist) sowie Entstehung und Potential von Intrigen und verfügt darüber hinaus über viele gesellschaftssatirische Momente, wenn der Umgang im Dorf untereinander aufs Korn genommen wird. Einzig schade ist es insbesondere vor diesem Hintergrund, dass es den Galliern leider nicht gelingt, entsprechend rein mit List, Tücke und Psychologie zu reagieren, sondern man einmal mehr auf den Zaubertrank zurückgreifen muss, der ihnen übermenschliche Kräfte verleiht.
Der 15. Band der frankobelgischen Comic-Reihe „Asterix“ um das renitent wehrhafte gallische Dorf, das sich mithilfe eines Zaubertranks gegen die römischen Invasoren zur Wehr setzt, erschien erstmals 1970 und in der bekannten 48-seitigen Albenform in Deutschland 1973. Die Römer engagieren Destructivus, um Zwietracht bei den Galliern zu sähen und diese dadurch zu spalten, um sie – derart geschwächt – leichter bekämpfen und schließlich ihr Dorf einnehmen können. „Streit um Asterix“ bietet damit einen schönen humoristischen Exkurs in psychologische Kriegsführung (was auch Anlass für einen gelungenen Running Gag ist) sowie Entstehung und Potential von Intrigen und verfügt darüber hinaus über viele gesellschaftssatirische Momente, wenn der Umgang im Dorf untereinander aufs Korn genommen wird. Einzig schade ist es insbesondere vor diesem Hintergrund, dass es den Galliern leider nicht gelingt, entsprechend rein mit List, Tücke und Psychologie zu reagieren, sondern man einmal mehr auf den Zaubertrank zurückgreifen muss, der ihnen übermenschliche Kräfte verleiht. Einer der beliebtesten Mad-Stammzeichner war Don Martin mit seinen charakteristischen Figuren mit ihren langen Gesichtern und umgeknickten Zehen. „Er galt als Meister des bebilderten Slapsticks und des schwarzen Humors“, weiß die Wikipedia zu berichten und fasst damit treffend Martins inhaltlichen Stil zusammen. An Martin war es auch, mit „Don Martin hat Premiere“ die Mad-Taschenbuchreihe zu eröffnen, doch leider liegt mir jenes Debüt nicht vor. Für die 1976 erschienene Nummer 11 aber durfte er erneut den Stift schwingen: Er zeichnete die Abenteuer von Fester und Karbunkel, einem unternehmungslustigen, bauernschlauen, etwas kleingeratenen Schlitzohr und seinem Kumpel, einem stupiden, grobschlächtigen doch gutmütigen Simpel, der kaum mehr als Grunzlaute herausbekommt. Da beide ständig pleite sind, befinden sie sich vornehmlich auf Jobsuche, was sie in meist ungut aussehende Situationen bringt. Unterteilt in acht Kapitel verschlägt es sie in den Wilden Westen, auf den Rummelplatz in den Schrebergarten oder ins Kaufhaus, was eine Menge Gefahren mit sich bringt. Mit dem Platz ging man seitens Mad recht großzügig um und platzierte pro Seite lediglich ein Panel, so dass sich das Büchlein schnell durchblättert. Fairerweise erhöhte man die Seitenzahl von den sonst üblichen 160 dafür auf über 220. In Kombination mit den Leser beleidigendem Rückentext und Don Martin beleidigendem Vorwort ist „Don Martin tanzt aus der Reihe“ der erwartete kurzweilige Spaß, der Lust auf mehr von Martins Absurditäten macht, wenngleich er seinen Zenit hiermit noch längst nicht erreicht hatte.
Einer der beliebtesten Mad-Stammzeichner war Don Martin mit seinen charakteristischen Figuren mit ihren langen Gesichtern und umgeknickten Zehen. „Er galt als Meister des bebilderten Slapsticks und des schwarzen Humors“, weiß die Wikipedia zu berichten und fasst damit treffend Martins inhaltlichen Stil zusammen. An Martin war es auch, mit „Don Martin hat Premiere“ die Mad-Taschenbuchreihe zu eröffnen, doch leider liegt mir jenes Debüt nicht vor. Für die 1976 erschienene Nummer 11 aber durfte er erneut den Stift schwingen: Er zeichnete die Abenteuer von Fester und Karbunkel, einem unternehmungslustigen, bauernschlauen, etwas kleingeratenen Schlitzohr und seinem Kumpel, einem stupiden, grobschlächtigen doch gutmütigen Simpel, der kaum mehr als Grunzlaute herausbekommt. Da beide ständig pleite sind, befinden sie sich vornehmlich auf Jobsuche, was sie in meist ungut aussehende Situationen bringt. Unterteilt in acht Kapitel verschlägt es sie in den Wilden Westen, auf den Rummelplatz in den Schrebergarten oder ins Kaufhaus, was eine Menge Gefahren mit sich bringt. Mit dem Platz ging man seitens Mad recht großzügig um und platzierte pro Seite lediglich ein Panel, so dass sich das Büchlein schnell durchblättert. Fairerweise erhöhte man die Seitenzahl von den sonst üblichen 160 dafür auf über 220. In Kombination mit den Leser beleidigendem Rückentext und Don Martin beleidigendem Vorwort ist „Don Martin tanzt aus der Reihe“ der erwartete kurzweilige Spaß, der Lust auf mehr von Martins Absurditäten macht, wenngleich er seinen Zenit hiermit noch längst nicht erreicht hatte.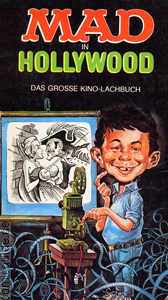 Die klassischen Mad-Hefte begannen i.d.R. mit einem mehrseitigen Comic, der einen aktuellen Kinofilm, eine Serie, eine TV-Show o.ä. persiflierte. Diese waren meist erfrischend frech und respektlos und trugen dazu bei, den typischen Mad-Humor zu prägen. Mit dem Mitte der 1970er erschienen zehnten Taschenbuch erschienen diese in Deutschland erstmal gesammelt in Buchform: Auf rund 160 Seiten werden nach einem die Zeichner Jack Davis und Mort Drucker sowie den Autoren Dick De Bartolo beleidigenden Vorwort fünf Filmgenres abgedeckt: „Seenot“ persifliert den Untergang der Titanic und ähnliche Katastrophenfilme und bezieht seinen Humor in erster Linie aus einem komplett unfähigen Kapitän, „Mord um Mitternacht“ nimmt die „Der dünne Mann“-Krimis köstlich aufs Korn, „Flug 1313“ klingt nach einem weiteren Katastrophenfilm, ist jedoch eine amüsante Abhandlung über menschlichen Opportunismus und Doppelmoral angesichts des drohenden Todes, „Dr. Krankenscheins Fluch“ ist eine „Frankenstein“-Persiflage, die es auf Mad-Scientist-Klischees abgesehen hat und „Goldene Träume, gebrochene Herzen“ parodiert kitschige Musicals, ihre Oberflächlichkeit und den immensen Druck hinter den Kulissen, dem sich die Darsteller ausgesetzt sehen. Mein humoristischer Favorit ist „Mord um Mitternacht“, inhaltlich hat es „Flug 1313“ am stärksten in sich, meinen Humor treffen jedoch alle fünf Geschichten. Nicht nur für Filmfreunde ein schöner Spaß, der sich allen Kino-Trends zum Trotz erstaunlich wenig abgenutzt hat.
Die klassischen Mad-Hefte begannen i.d.R. mit einem mehrseitigen Comic, der einen aktuellen Kinofilm, eine Serie, eine TV-Show o.ä. persiflierte. Diese waren meist erfrischend frech und respektlos und trugen dazu bei, den typischen Mad-Humor zu prägen. Mit dem Mitte der 1970er erschienen zehnten Taschenbuch erschienen diese in Deutschland erstmal gesammelt in Buchform: Auf rund 160 Seiten werden nach einem die Zeichner Jack Davis und Mort Drucker sowie den Autoren Dick De Bartolo beleidigenden Vorwort fünf Filmgenres abgedeckt: „Seenot“ persifliert den Untergang der Titanic und ähnliche Katastrophenfilme und bezieht seinen Humor in erster Linie aus einem komplett unfähigen Kapitän, „Mord um Mitternacht“ nimmt die „Der dünne Mann“-Krimis köstlich aufs Korn, „Flug 1313“ klingt nach einem weiteren Katastrophenfilm, ist jedoch eine amüsante Abhandlung über menschlichen Opportunismus und Doppelmoral angesichts des drohenden Todes, „Dr. Krankenscheins Fluch“ ist eine „Frankenstein“-Persiflage, die es auf Mad-Scientist-Klischees abgesehen hat und „Goldene Träume, gebrochene Herzen“ parodiert kitschige Musicals, ihre Oberflächlichkeit und den immensen Druck hinter den Kulissen, dem sich die Darsteller ausgesetzt sehen. Mein humoristischer Favorit ist „Mord um Mitternacht“, inhaltlich hat es „Flug 1313“ am stärksten in sich, meinen Humor treffen jedoch alle fünf Geschichten. Nicht nur für Filmfreunde ein schöner Spaß, der sich allen Kino-Trends zum Trotz erstaunlich wenig abgenutzt hat.