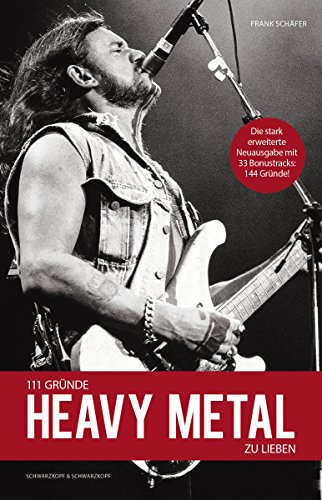
Zwischen seinen im Oktober-Verlag erschienenen Rezensionssammlungen „Alte Autos und Rock’n’Roll“ und „Rumba mit den Rumsäufern“ veröffentlichte der Braunschweiger Dr. phil. Frank Schäfer, seines Zeichens Literaturkenner, Journalist, Romanautor und Ex-Gitarrist der Band „Salem’s Law“, im Berliner Verlag Schwarzkopf & Schwarzkopf ein Taschenbuch mit dem Titel „111 Gründe, Heavy Metal zu lieben“. Das war im Jahre 2010 und nach seinem arg durchwachsenen ersten Versuch „Heavy Metal – Geschichten, Bands und Platten“ aus dem Jahre 2001 das zweite Mal, dass sich Schäfer bei seinen Buchveröffentlichungen explizit auf den Heavy Metal bezog. Wie sehr es sich der Gelehrte mittlerweile traute, offen zu seiner musikalischen Vorliebe zu stehen, lässt bereits der Titel erkennen. Wollte er 2001 vor allem seinen akademischen Kolleg(inn)en etwas beweisen, nämlich wie wissenschaftlich-verschwurbelt man auch als Metaller schreiben kann, so hatte er diese Marotte 2010 noch nicht ganz abgelegt, schrieb nun aber zu gleichen Maßen für Gleichgesinnte, sprich: für Metal-Fans. Den gesellschaftlichen Hintergrund werden Jüngere eventuell nicht mehr kennen, aber lange Zeit war es tatsächlich so, dass Hardrock und Heavy Metal als primitive Musik für ebensolche Menschen galten, und für je elitärer sich ein Bildungsbürger gebärdete, desto tiefer waren Vorurteile und Ablehnung verankert. Doc Schäfers Umgang damit ist somit auch ein aufschlussreiches Zeitzeugnis.
Nachdem ich von Schäfers Stil, über Musik und Subkultur zu schreiben, einst durch seine „Metal Störies“ aus dem Jahre 2013 angefixt worden war, hatte ich mir die geschmackvoll gestaltete erweiterte Neuausgabe der „111 Gründe“ zu Weihnachten schenken lassen. Diese kommt nicht nur als rund 300-seitige gebundene Ausgabe im festen Deckel und mit Schutzumschlag daher, sondern wurde auch um satte 33 Bonusgründe ergänzt. Inklusive Hidden Bonus Track bringt es der Schmöker also auf 145 Kapitel, jeweils zwischen einer und vier bilderlosen Seiten lang und aufgeteilt in die neun Abschnitte Geschichte, Fans, Musik, Theorie, Kultur, Stile, Welt, Listen und Bonustracks, in denen Schäfer stilistisch zwischen Belletristik und Sachbuch mäandert. Ob es eine so gute Idee war, Motörhead-Lemmy auf den Umschlag zu packen, der zeitlebens mit dem Metal-Etikett fremdelte und stets angab, lediglich Rock’n’Roll zu spielen, sei mal dahingestellt – ein wesentlich ansprechenderer Blickfang als die hässliche Illustration auf der Erstauflage ist er in jedem Fall.
Um es gleich vorwegzunehmen: Die einzelnen Kapitel hätten größtenteils (von den „Weil…“-Überschriften einmal abgesehen) unverändert auch in Schäfers mittlerweile zahlreichen Sammlungen aus Anekdoten, Essays, Rezensionen, Glossen und Konzertberichten erscheinen können. Schäfer dürfte sich also nicht sein Konzept inklusive 111 bzw. 145 Gründen überlegt und dann zu den jeweiligen Themen etwas geschrieben, sondern seine bisher unveröffentlichten Texte eher nachträglich in Hauptkapitel eingeteilt und sich die zum jeweiligen Text passenden „Gründe“ abgeleitet haben. Das macht aber nichts, sondern sorgt vielmehr für eine große thematische Breite und schriftstellerische Freiheit – schließlich wurde eine zum Inhalt passende Form gefunden und nicht umgekehrt.
Nein einem hervorragenden Einführungstext geht’s dann Schlag auf Schlag, Kapitel für Kapitel. Anfangs zitiert Schäfer viel aus historischen Musikkritiken von Lester Bangs und Konsorten und behandelt die frühe Entwicklung des Genres. Auf Seite 22 blitzt erstmals der Schäfer’sche Humor in Form von Selbstironie hervor, wenn er seine eigene Kapelle als „ihrer Zeit um Jahrzehnte vorauseilende Prog-Metal-Band“ bezeichnet und als kleinen Running Gag etabliert. Schön, dass er auch auf Metal in der DDR eingeht – ein besonders spannendes Kapitel jüngerer deutscher Musikgeschichte, wie ich finde (und vor ungefähr zwei Jahren recht ausführlich in den Fachmagazinen Deaf Forever und Rock Hard aufgearbeitet). Dass „Die Königin der Verdammten“ einen Metal-Soundtrack haben soll, hat mich daran erinnert, mir den Film endlich einmal zu besorgen (und „Rock Star“ sollte ich mir wohl auch einmal ansehen). Schäfer datiert eine allgemeine ‘80er-Musikrenaissance, von der auch der Metal betroffen gewesen sei, auf den Beginn des neuen Jahrtausends und führt als Hauptgrund die nostalgischen Gefühle gealterter Metal-Hörer(innen) an. Das spielte sicherlich eine Rolle. Stärker würde ich jedoch gewichten, dass der Metal in den 1990ern seine experimentelle Phase durchgemacht hat, wie es wohl jedes Genre einmal tut, und sich danach genau angeschaut wurde, was davon gelungen war und was wegkann, um sich alsbald wieder auf seine eigentlichen Stärken zu berufen. Eine wichtige Rolle dürfte dabei die Veröffentlichung des Albums „Brave New World“ der wiedererstarkten Iron Maiden gespielt haben, einem Meilenstein des Genres und neuem Orientierungsfixpunkt für möglicherweise in den ‘90ern verirrte Headbanger(innen). Wenn Schäfer in diesem Kontext Heavy-Metal-Fans Konservatismus unterstellt, ist damit keinesfalls dessen gesellschafts- und parteipolitische, mit reaktionär besser umschriebene Entsprechung gemeint, sondern die positiv konnotierte Pflege und Erhalt des Pudels genre- und kulturkonstituierenden Kerns.
Im Fans-Abschnitt zitiert Schäfer mehrmals Chuck Klostermann, seines Zeichens Autor Poser-/Hair-/Glam-Metal verklärender Schriften, dem ich grundsätzlich skeptisch gegenüberstehe, und bringt mit Grund Nr. 23 eine Anekdote ohne erkennbaren Metal-Bezug unter. Aber er vermeidet glücklicherweise auch allzu soziologische Erklärungsversuche und erinnert sich daran, für die Fans zu schreiben, denen er ein paar eindeutig sympathisierende, informative oder schlicht erheiternde Anekdoten kredenzt. Geht es schließlich als Kapitelüberbau um die Musik, notierte ich mir zunächst, meiner Prog-Ignoranz zum Trotz (proggier als Iron Maiden und Mercyful Fate in so manch Komposition brauche ich’s wirklich nicht), dann doch noch mal in Rushs „Snakes & Arrows“ reinzuhören. Ein ganzes Kapitel widmet Schäfer der Entwicklung AC/DCs nach „Back in Black“, beginnt also bewusst mit deren Saure-Gurken-Zeit. Da scheiden sich die Geister, denn natürlich fiel es der Band schwer, an die Bon-Scott-Ära und das Brian-Johnson-Debüt anzuknüpfen, retrospektiv betrachtet war dann aber bei Weitem doch nicht alles scheiße, was nach Diesel, Fusel und australischem Schweiß stank: „Flick of the Switch“ kommt bei mir besser weg als „For Those About To Rock (We Salute You)“, denn am Titelstück kann ich im Gegensatz zu Schäfer nichts Kritikwürdiges entdecken, an „Bedlam in Belgium“ ebenso wenig, und neben dem von Schäfer positiv hervorgehobenen „Guns For Hire“ gibt’s doch wohl auch am etwas härteren „Brain Shake“ wenig auszusetzen. Ok, bei „Landslide“ hat er recht, der klingt wirklich recht gehetzt und kann das leider nicht mit einem memorablen Refrain ausgleichen. Dafür ist mir im Gegensatz zu Schäfer „Deep in the Hole“ zu lahmarschbluesig. „This House Is On Fire“ kann aber tatsächlich zu wenig. „[I]st hier auch nur ein einziger Song der Rede wert?“, fragt Schäfer in Bezug aufs Nachfolgealbum „Fly on the Wall“. Nun, hat man sich erst einmal an den nicht ganz optimalen Schlagzeugsound gewöhnt, wissen mindestens das Titelstück sowie „First Blood“ und „Playing With Girls“ so sehr zu gefallen, dass sie es in meine Best-of-Playlist geschafft haben. Auf die Soundtrack-Mini-LP „Who Made Who“ folgte dann aber auch schon mit „Blow Up Your Video“ ein starkes Album, das mitnichten lediglich einen einzigen erinnerungswürdigen Song enthält: Zu „Heatseaker“ gesellten sich mit „That’s The Way I Wanna Rock ’n‘ Roll“, „Nick Of Time“ und „Two’s Up“ ein paar richtig gute Songs, weshalb ich das Hit-Album „The Razors Edge“ eher als Steigerung des mit „Blow Up Your Video“ eingeschlagenen Weges betrachte denn als aus dem Nichts kommende Überraschung. Weit mehr als „ein lahmarschiger Ausrutscher“ ist dann auch der 1995er-Nachfolger „Ballbreaker“, meine Best-of zählt gleich sieben Einträge! Der von Schäfer skizzierten Entwicklung der Band muss ich also zumindest in Teilen widersprechen. Aber das nur am „Rande“ (ähem…).
Noch einmal zu AC/DC, weil Schäfer die Band im unmittelbar folgenden „Grund Nr. 35: Weil Heavy Metal nicht immer viel bedeuten muss“ ebenfalls erneut aufgreift und ihre „Rock’n’Roll Train“-Lyrics auseinandernimmt: Der Text ist leider falsch zitiert. Lag kein Booklet vor und er hat versucht, ihn eigenohrig herauszuhören? Oder eventuell irgendeine Internetquelle ungeprüft bemüht? Wer sich nun fragt, wie Heavy Metal und AC/DC eigentlich zusammenpassen, tut das zurecht, den egal, ob man die Band nun als Hard-, Blues-, Boogie-Rock oder Rock’n’Roll klassifiziert, Metal im eigentlichen Sinne ist’s nicht. Hardrock und Metal gingen aber schon immer Hand in Hand miteinander einher, die Übergänge („Heavy Rock“?) sind fließend und Schäfer hat ohnehin eine ausgeprägte Schwäche für Bands, die die reine Metal-Lehre nun nicht unbedingt verinnerlicht haben (Southern-Rock-Gedöns, skandinavischer Rotzrock, Thin Lizzy, unverständlicherweise sogar Ratt und Konsorten…) und berücksichtigt beispielsweise auch die Punkband Bad Religion in seinem Buch. Ein bisschen schade ist es schon, dass, geht es konkret um Bands, relativ wenig aus dem klassischen Metal-Bereich behandelt wird, der Großteil der Kapitel widmet sich aber ohnehin bandübergreifenden Belangen. Das gilt selbstverständlich nicht für die Metallica-Abhandlung, die in Details streitbar ist, ich nach meinen AC/DC-Abschweifungen nun aber nicht auseinanderklamüsern werden. Seinen Abschnitt über harte Gitarrenmusik aus Skandinavien hingegen hätte Schäfer gern in die einzelnen Länder aufteilen dürfen, denn die norwegische(n) Szene(n) unterscheiden sich doch stark von der/den schwedischen usw. In aller Kürze setzt sich Schäfer mit den Motörhead-Alben der Jahre 2002 bis 2008 auseinander, was mich anregt, es ihm bei Gelegenheit einmal gleichzutun – auch wenn sie nicht zu den großen Klassikern zählen, dürfte es auf den Alben des aktuellen Jahrtausends doch das eine oder andere zu entdecken geben.
Wenn Schäfer im Theorie-Teil gewissermaßen einen Schritt aus dem Musikzirkus herausmacht und mehr eine observierend Position einnimmt, ist das nicht minder lesenswert, insbesondere wenn er die bandübergreifend Hell/dunkel- bzw. Blond/schwarzhaarig-Kontrastierungen ausmacht und erläutert – das war mir neu und ist gut beobachtet. In den Kultur-Teil steigt Schäfer mit einer Van-Halen-Ehrerbietung ein, auf die hin man Lust bekommt, sich alle genannten Alben sofort ins Regal zu stellen bzw. besser noch: aufzulegen. Auch darüber hinaus ist dieses Hauptkapitel besonders interessant ausgefallen, da die Gelegenheit genutzt wird, diverse Besonderheiten ins Gedächtnis zu rufen, die üblicherweise nicht unbedingt mit Hardrock und Metal assoziiert werden. Hineingeschmuggelt hat Schäfer eine sehr persönliche Episode, die Bezug auf den (ungerechtfertigten) Verriss des einzigen Salem’s-Law-Albums in der Metal-Hammer-Postille sowie die einige Jahre später im Rock Hard veröffentlichte Minuskritik eines seiner Bücher nimmt und mit der Schäfer suggeriert, negative Kritik mit Humor nehmen zu können. Auf einer Doppelseite gibt es dann sogar doch etwas zu sehen, nämlich sechs von Christopher Szpajdel gestaltete Bandlogos.
Der Abschnitt Stile deckt streng subjektiv lediglich von Schäfer goutierte Spielarten der Musik ab, dafür jeweils erzählerisch gut verpackt. In Welt werden Schlaglichter auf regionale Eigenheiten geworfen und hier und da ein exotischer Touch eingebracht, während Listen (Metal-Fans lieben Listen!) Butter die Fische gibt und neben lesenswerten Metal-Büchern sowie sehenswerten Metal-Filmen Lemmys „vier beste Journalistenbeleidigungen“ aufführt und Schäfers persönliche Genre-Top-50-Songs auflistet. Allerdings fantasiert er sich auch eine All-Time-Albumcharts-Top-50 zusammen, der eher sein persönlicher Geschmack denn reale Verkaufszahlen zugrunde liegen dürften. Ein echter Fauxpas ist der Einstieg in dieses Kapitel, denn die Aufzählung vermeintlich „schönste[r] T-Shirt-Sprüche“ enthält fast ausschließlich peinlichen EMP-„Fun-Shirt“-Kokolores. Die Bonusgründe sind tatsächlich eine schöne Ergänzung, die die Neuauflage deutlich aufwertet. In Grund Nr. 137 findet sich einer der Schäfer-Klassiker schlechthin, seine in Variationen immer mal wieder aufgegriffene Lieblings-AC/DC-Anekdote.
Nein, man muss sicherlich nicht bei allem der Meinung des Autors sein oder gar seinen mitunter befremdlichen Geschmack teilen, aber das Schöne an dieser ideal zum häppchenweisen Lesen geeigneten Schwarte ist die ansteckende Leidenschaft, die Schäfer für den Gegenstand seiner Betrachtungen verspürt. So halte ich es durchaus für möglich, dass, wer noch nicht tiefergehender mit der Materie vertraut ist, nach der Lektüre die Faszination für diese Art von Musik besser wird nachvollziehen können. Zudem tritt Schäfer den Beweis an, dass es allen Unkenrufen zum Trotz mehr als Musik ist und um mehr als um Musik geht. Dieses bunte, eher lose angeordnete Mosaik vermittelt bei aller lockeren Schreibe und Neigung zum Anekdotischen zudem Wissen zu einigen wichtigen Bands, betreibt Liebhaberei für Interpreten aus der zweiten Reihe, kommentiert Phänomene und Entwicklungen und ist immer dann am besten, wenn Schäfer seinen Humor unterbringen kann, wofür er sich den einen oder anderen „Grund“ dann auch explizit reserviert. Wünschenswert wäre jedoch gewesen, Schäfer hatte etwas weniger kritiklos das Wacken Open Air abgefeiert und stattdessen ein, zwei andere Festivals zum Schauplatz seiner Episoden gemacht.
Nicht so wirklich komme ich auf den Irrglauben klar, Bandnamen seien etwas Heiliges, die in Komposita nicht mit so etwas Profanem wie Bindestrichen belästigt werden dürfen. Will sagen: Hier ist von „Thin Lizzy-Alben“ die Rede, nicht von Thin-Lizzy-Alben. Damit ist Schäfer aber keineswegs allein auf weiter Flur, dieser Unfug zieht sich durch viele Publikationen. Durch mehrere Publikationen Schäfers zieht sich übrigens auch das eine oder andere Kapitel: Mindestens jenes zu den Hellacopters war mir bereits bekannt, und, hey, über Grund Nr. 119 bin ich doch kürzlich erst in „Hühnergötter“ gestolpert, oder? Apropos stolpern: „Trash“ (statt Thrash), „Minor Thread“ (statt Minor Threat), „Death-Metall” und „throungh“ sind ein paar etwas unglückliche Fehler, die dem Lektorat durchgerutscht sind.
Davon unberührt bleibt, wie gut es Schäfer gelingt, beinahe alles in einem erzählerischen Stil zu formulieren, der nicht mal halb so trocken wie vermutlich diese Kritik hier ausgefallen ist, sondern im Gegenteil mit lebendiger Sprache überzeugt – wären da nicht diese Was-zur-Hölle-Momente, wenn Schäfer wieder zum Fremdwörterlexikon greift und uns „zirzensisch“ (S. 70), „Intrikatheit“ (S. 77 – gibt es das Wort überhaupt?), „Gallimathias“ (S. 126 – der Matze hat’s doch so mit der Galle…), „indigniert“ (S. 148), „Obstinatheit“ (S. 201 – kennt der Duden nicht, scheint sich also um eine Frankschäferheit zu handeln) u. ä. mehr um die Ohren hat, um dann doch wieder mit seinem Wortschatz zu protzen wie ein Yngwie J. Malmsteen in Schlangenlederstiefeln mit seiner Saitenflitzerei – und so wenig songdienlich wie letztere meist ist, ist Schäfers Vokabular dem Lesegenuss zugutekommend. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, generell mit Schäfers Stil und Herangehensweise etwas anfangen kann, eine Schwäche für diese Musik hat oder schlicht neugierig ist, dürfte mit dem Buch seine Freude haben und sicherlich die eine oder andere Stunde damit verbringen, diesen oder jenen während der Lektüre aufgeschnappten musikalischen Tipp zu evaluieren. Meine Kritikpunkte sind konstruktiv zu verstehen, denn unterm Strich komme ich Pi mal Daumen auf 111 Gründe, die für dieses Buch sprechen.
 Als ideale Reiselektüre empfiehlt sich das 29. deutsche Mad-Taschenbuch, das 1981 – zwei Jahre nach der US-amerikanischen Originalausgabe – auch hierzulande erschienen ist und das Debüt des Duos Frank Jacobs (Text) und Paul Peter Porges (Zeichnungen) innerhalb dieser Reihe darstellte. Nach einem Vorwort des Redakteurs Nick Meglin wird in 17 abwechslungsreichen Kapiteln im gewohnten Umfang von rund 160 Schwarzweißseiten das Thema Reisen auf humorvolle bis satirische Weise abgehandelt. Zu aus einzelnen Karikaturen und etwas Text bestehende „Du weißt, du hättest lieber zuhause bleiben sollen, wenn…“– und „Die Lust am Reisen kann einem total vergehen, wenn…“-Gags, einem Reisequiz in mehreren Teilen und typischen Phrasen für verschiedene touristische Ziele gesellen sich erzählerische, mehrseitige kleine bebilderte Geschichten wie „Sechs langweilige Tage für langweilige Menschen“ oder der Comic vom Besuch bei einem Fluglotsen, mit grafischen Perspektiven operierende Gags wie verschiedenen Ansichten des schiefen Turms von Pisa und in Comicform dargereichte „Dumm und schlau auf Reisen“-Gegenüberstellungen. Textlastiger fallen die Urlaubskarten und ihre „Übersetzungen“ durch die Mad-Redaktion aus, schneller durchgeblättert hingegen sind die „ausländischen Warnschilder, die man unbedingt kennen muss“. Somit ist dieses Taschenbuch eine Sammlung thematisch verwandter Gags in verschiedenen Darreichungsformen, die zahlreiche Klischees aufs Korn nehmen, dabei insbesondere aus heutiger Sicht nicht immer politisch korrekt ausfallen und zu einem vergnüglichen Reisebegleiter für ironie- und sarkasmusbegabte Menschen mit einer Vorliebe für den typischen Mad-Humor werden – wenngleich aufgrund der globalen Entwicklungen seit Erscheinen des Buchs nicht alle aufgegriffenen und überspitzt verarbeiteten Beobachtungen noch Gültigkeit besitzen.
Als ideale Reiselektüre empfiehlt sich das 29. deutsche Mad-Taschenbuch, das 1981 – zwei Jahre nach der US-amerikanischen Originalausgabe – auch hierzulande erschienen ist und das Debüt des Duos Frank Jacobs (Text) und Paul Peter Porges (Zeichnungen) innerhalb dieser Reihe darstellte. Nach einem Vorwort des Redakteurs Nick Meglin wird in 17 abwechslungsreichen Kapiteln im gewohnten Umfang von rund 160 Schwarzweißseiten das Thema Reisen auf humorvolle bis satirische Weise abgehandelt. Zu aus einzelnen Karikaturen und etwas Text bestehende „Du weißt, du hättest lieber zuhause bleiben sollen, wenn…“– und „Die Lust am Reisen kann einem total vergehen, wenn…“-Gags, einem Reisequiz in mehreren Teilen und typischen Phrasen für verschiedene touristische Ziele gesellen sich erzählerische, mehrseitige kleine bebilderte Geschichten wie „Sechs langweilige Tage für langweilige Menschen“ oder der Comic vom Besuch bei einem Fluglotsen, mit grafischen Perspektiven operierende Gags wie verschiedenen Ansichten des schiefen Turms von Pisa und in Comicform dargereichte „Dumm und schlau auf Reisen“-Gegenüberstellungen. Textlastiger fallen die Urlaubskarten und ihre „Übersetzungen“ durch die Mad-Redaktion aus, schneller durchgeblättert hingegen sind die „ausländischen Warnschilder, die man unbedingt kennen muss“. Somit ist dieses Taschenbuch eine Sammlung thematisch verwandter Gags in verschiedenen Darreichungsformen, die zahlreiche Klischees aufs Korn nehmen, dabei insbesondere aus heutiger Sicht nicht immer politisch korrekt ausfallen und zu einem vergnüglichen Reisebegleiter für ironie- und sarkasmusbegabte Menschen mit einer Vorliebe für den typischen Mad-Humor werden – wenngleich aufgrund der globalen Entwicklungen seit Erscheinen des Buchs nicht alle aufgegriffenen und überspitzt verarbeiteten Beobachtungen noch Gültigkeit besitzen.
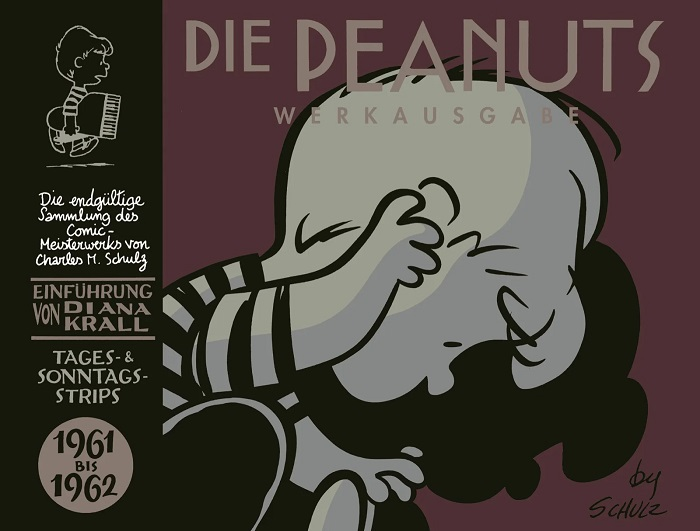
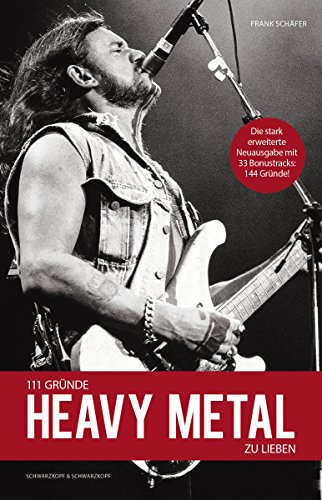
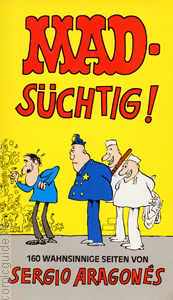 Mad-Urgestein Sergio Aragones‘ fünfter Band innerhalb der Mad-Taschenbuchreihe erschien im US-amerikanischen Original bereits im Jahre 1977, drei Jahre später folgte die deutsche Ausgabe. Aragones blieb seinem Stil treu und füllte die rund 160 Schwarzweißseiten mit ein- bis dreiseitigen gezeichneten Gags ohne jede Sprech- oder Denkblase oder sonstigen Text. Seine karikierenden Strichzeichnungen sind unverkennbar und enthalten einfache, aber auch etwas hintergründige Witze, die diesmal besonders gern diverse Klischees aufs Korn nehmen. Mitunter tummeln sich in einzelnen Bildern fast schon wimmelbildartig solch viele Details, dass man genauer hingucken muss, um alles zu erfassen oder auch, um die Pointe nicht zu verpassen. Dieser Umstand führt dazu, dass der Lesefluss immer mal wieder etwas gebremst wird, wodurch man das recht großzügig mit seinen Platzverhältnissen umgehende Büchlein nicht ganz so schnell durchgeblättert hat, wie es zunächst den Anschein haben mag. Schön auch, wie die Titelzeichnung auf der allerletzten Seite fortgesetzt wird.
Mad-Urgestein Sergio Aragones‘ fünfter Band innerhalb der Mad-Taschenbuchreihe erschien im US-amerikanischen Original bereits im Jahre 1977, drei Jahre später folgte die deutsche Ausgabe. Aragones blieb seinem Stil treu und füllte die rund 160 Schwarzweißseiten mit ein- bis dreiseitigen gezeichneten Gags ohne jede Sprech- oder Denkblase oder sonstigen Text. Seine karikierenden Strichzeichnungen sind unverkennbar und enthalten einfache, aber auch etwas hintergründige Witze, die diesmal besonders gern diverse Klischees aufs Korn nehmen. Mitunter tummeln sich in einzelnen Bildern fast schon wimmelbildartig solch viele Details, dass man genauer hingucken muss, um alles zu erfassen oder auch, um die Pointe nicht zu verpassen. Dieser Umstand führt dazu, dass der Lesefluss immer mal wieder etwas gebremst wird, wodurch man das recht großzügig mit seinen Platzverhältnissen umgehende Büchlein nicht ganz so schnell durchgeblättert hat, wie es zunächst den Anschein haben mag. Schön auch, wie die Titelzeichnung auf der allerletzten Seite fortgesetzt wird. ISBN: 3-89324-100-0
ISBN: 3-89324-100-0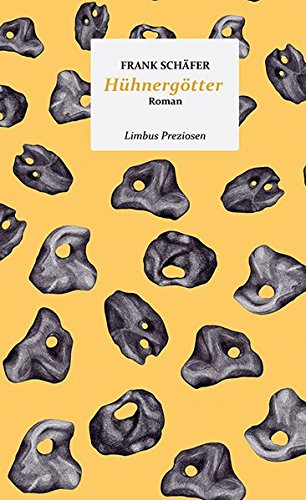 Für seinen im Jahre 2017 im Innsbrucker Limbus-Verlag in gebundener Form veröffentlichten Roman „Hühnergötter“ schlüpft der freie Braunschweiger Journalist, Autor und Literaturkritiker sowie Ex-Heavy-Metal-Gitarrist Frank Schäfer rund 200 Seiten und 25 Kapitel lang erneut in die Rolle seines Alter Ego Friedrich „Fritz“ Pfäfflin – zehn Jahre nach
Für seinen im Jahre 2017 im Innsbrucker Limbus-Verlag in gebundener Form veröffentlichten Roman „Hühnergötter“ schlüpft der freie Braunschweiger Journalist, Autor und Literaturkritiker sowie Ex-Heavy-Metal-Gitarrist Frank Schäfer rund 200 Seiten und 25 Kapitel lang erneut in die Rolle seines Alter Ego Friedrich „Fritz“ Pfäfflin – zehn Jahre nach  Die Journalisten Ralf Heimann und Jörg Homering-Elsner sammeln seit einigen Jahren auf ihrer Facebook-Seite „Perlen des Lokaljournalismus“ (und deren Pendant „Kurioses aus der Presseschau“) Mumpitz, Stuss und Stilblüten, den deutschsprachige Zeitungen in Printform und auf ihren Web-Präsenzen anscheinend unablässig produzieren. Eine Art Best of bot bereits das im Münchner Wilhelm-Heyne-Verlag erschienene querformatige Taschenbuch „Lepra-Gruppe hat sich aufgelöst“. Im Jahre 2017 folgte dessen Nachfolger „Bauchchirurg schneidet hervorragend ab“.
Die Journalisten Ralf Heimann und Jörg Homering-Elsner sammeln seit einigen Jahren auf ihrer Facebook-Seite „Perlen des Lokaljournalismus“ (und deren Pendant „Kurioses aus der Presseschau“) Mumpitz, Stuss und Stilblüten, den deutschsprachige Zeitungen in Printform und auf ihren Web-Präsenzen anscheinend unablässig produzieren. Eine Art Best of bot bereits das im Münchner Wilhelm-Heyne-Verlag erschienene querformatige Taschenbuch „Lepra-Gruppe hat sich aufgelöst“. Im Jahre 2017 folgte dessen Nachfolger „Bauchchirurg schneidet hervorragend ab“.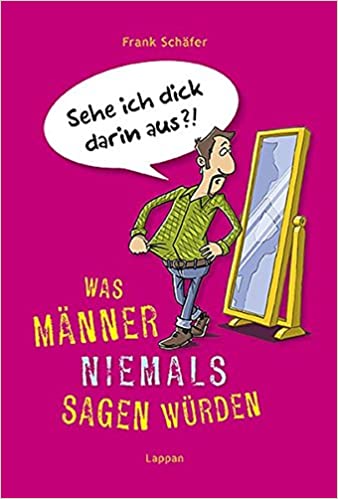 Nanu? Frank Schäfer goes Mario Barth und macht sich über das weibliche Geschlecht auf Grundlage überholter Klischees für ein paar wohlfeile Pointen lustig? Keine Sorge, zwischen seinen Metal-Büchern „Metal Störies“ und „Metal Antholögy – Ansichten und Meinungen eines Schwermetallsüchtigen“ veröffentlichte der Braunschweiger Dr. phil. und Autor, bekannt für seine Literaturkritik, seine biographisch geprägten Romane und seine popkulturellen Essays mit schwermetallischer Schlagseite, im Jahre 2013 ein humoristisches, rund 190-seitiges Taschenbuch im Oldenburger Lappan-Verlag, das vornehmlich männliche Geschlechtsgenossen aufs Korn nimmt.
Nanu? Frank Schäfer goes Mario Barth und macht sich über das weibliche Geschlecht auf Grundlage überholter Klischees für ein paar wohlfeile Pointen lustig? Keine Sorge, zwischen seinen Metal-Büchern „Metal Störies“ und „Metal Antholögy – Ansichten und Meinungen eines Schwermetallsüchtigen“ veröffentlichte der Braunschweiger Dr. phil. und Autor, bekannt für seine Literaturkritik, seine biographisch geprägten Romane und seine popkulturellen Essays mit schwermetallischer Schlagseite, im Jahre 2013 ein humoristisches, rund 190-seitiges Taschenbuch im Oldenburger Lappan-Verlag, das vornehmlich männliche Geschlechtsgenossen aufs Korn nimmt.
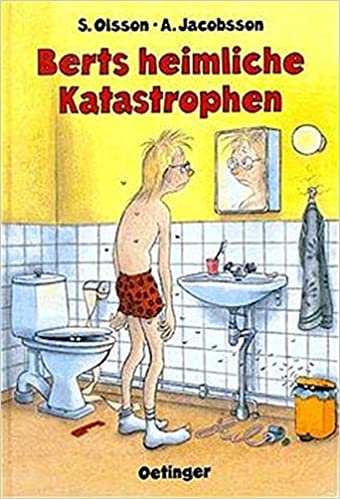 Die schwedischen Vettern, Lehrer und Schriftsteller Sören Olsson und Anders Jacobsson sind die Autoren der fünfzehnbändigen Jugendbuchreihe um den pubertierenden Bert Ljung, die dessen Leben vom zwölften bis zum 17. Lebensjahr skizziert. Von 1987 bis 1999 im schwedischen Original und von 1990 bis 2005 ins Deutsche übersetzt bei der Hamburger Verlagsgruppe Friedrich Oetinger veröffentlicht, scheint allen Bänden gemein, dass sie ausschließlich aus Berts Tagebucheinträgen bestehen – Olsson und Jacobsson versuchen sich also in die Psyche eines Schuljungen hineinzuversetzen und seine Erlebnisse aus seiner subjektiven Sicht im intimen Rahmen eines Tagesbuchs zu schildern.
Die schwedischen Vettern, Lehrer und Schriftsteller Sören Olsson und Anders Jacobsson sind die Autoren der fünfzehnbändigen Jugendbuchreihe um den pubertierenden Bert Ljung, die dessen Leben vom zwölften bis zum 17. Lebensjahr skizziert. Von 1987 bis 1999 im schwedischen Original und von 1990 bis 2005 ins Deutsche übersetzt bei der Hamburger Verlagsgruppe Friedrich Oetinger veröffentlicht, scheint allen Bänden gemein, dass sie ausschließlich aus Berts Tagebucheinträgen bestehen – Olsson und Jacobsson versuchen sich also in die Psyche eines Schuljungen hineinzuversetzen und seine Erlebnisse aus seiner subjektiven Sicht im intimen Rahmen eines Tagesbuchs zu schildern.